Laura Videla, Neuropsychologin, beantwortet noch offene Fragen zu ihrem Vortrag über die neuropsychologische Bewertung der kognitiven Beeinträchtigung bei Menschen mit Down-Syndrom.
Der Vortrag fand im vergangenen März im Rahmen von #YoMeQuedoEnCasa in Kooperation mit #NeuronUPAcademy statt.
Fragen zum Vortrag: Neuropsychologische Bewertung der kognitiven Beeinträchtigung bei Menschen mit Down-Syndrom
1. Die Neuropsychologiedoktorandin Ibeth Sosa stellt ihre Frage zum Vortrag über Menschen mit Down-Syndrom:
Frage:
Guten Tag aus Lateinamerika, Kolumbien. Ich bin Doktorandin in klinischer Neuropsychologie. Zurzeit forsche ich speziell an älteren Erwachsenen mit arterieller Hypertonie. Zunächst möchten wir das neuropsychologische Profil dieser Patientengruppe hinsichtlich ihrer starken kognitiven Funktionen kennenlernen. Außerdem wollen wir untersuchen, ob und inwieweit die Hypertonie die kognitive Leistung beeinflusst oder eine leichte kognitive Beeinträchtigung verursachen bzw. verschlimmern kann. Welche Empfehlungen würden Sie mir für diese Forschungsarbeit geben?
Vielen Dank.
Antwort:
Hallo Ibeth, ich freue mich, dich zu grüßen. Es tut mir leid, dass ich dir nicht konkret helfen kann, da dein Thesis-Thema nicht in meinem Fachbereich liegt. Meine Empfehlung bezieht sich eher auf methodische Aspekte. Ich rate dir, bevor du mit der Arbeit beginnst, eine sehr gründliche Literaturrecherche durchzuführen. Gleichzeitig solltest du versuchen, stets auf dem Laufenden zu bleiben, was zur Hypertonie und Kognition veröffentlicht wird. Zusammengefasst dient dir das zu mehreren Zwecken: Erstens hilft es dir, deine Ziele und Hypothesen zu definieren, und zweitens zu erkennen, welche zukünftigen Forschungsrichtungen es gibt. Außerdem unterstützt es dich bei der Festlegung deines neuropsychologischen Erhebungsprotokolls, indem du siehst, welche Tests sich als besonders nützlich und empfindlich bei dieser Patientengruppe erwiesen haben.
Ich hoffe, das ist hilfreich für dich. Viele Grüße und viel Erfolg!
Laura.
2. Neuropsychologin Clara Trompeta fragt zum pharmakologischen Vorgehen im zuletzt vorgestellten Fall:
Frage:
Zunächst einmal Gratulation an Laura. Mir scheint, dass du alles sehr klar vorgestellt hast und es war äußerst interessant. Ich bin Neuropsychologin und forsche zu kognitiven Beeinträchtigungen und Parkinsonismen. Meine Frage bezieht sich auf den zuletzt vorgestellten Fall. Obwohl es eher um die pharmakologische Behandlung als um Neuropsychologie geht: Warum wurde entschieden, dem Patienten ein Neuroleptikum zu geben, um dieses eher frontallappenbezogene Störungsbild zu verbessern, nachdem mnestische Ursachen ausgeschlossen wurden?
Danke und nochmals herzlichen Glückwunsch.
Antwort:
Vielen Dank für deinen Kommentar, Clara. Ich freue mich, dass dir der Vortrag zu Menschen mit Down-Syndrom gefallen hat. Mit dem letzten Fall wollte ich verdeutlichen, dass nicht jede kognitive Beeinträchtigung bei Patient*innen mit Down-Syndrom auf eine Alzheimer-Erkrankung zurückgeht. Vielmehr ist es wichtig, eine genaue Diagnose zu stellen, wobei uns die Neuropsychologie in diesem Prozess sehr unterstützen kann. Der Fall, den ich vorgestellt habe, weist nämlich seit Langem Verhaltensauffälligkeiten auf (Aggressivität, herausforderndes Verhalten usw.), aber ich habe nicht alle Details genannt, um nicht zu ausschweifend zu werden. Dieser Patient wird zudem psychiatrisch begleitet und es wurden schon zahlreiche unterschiedliche Behandlungsstrategien erprobt.
Quetiapin ist eine Substanz, die nachweislich Verhaltensauffälligkeiten bei Patient*innen mit Demenz verbessert. Außerdem haben wir festgestellt, dass Menschen mit Down-Syndrom (mit und ohne Demenz) gut auf dieses Medikament ansprechen. Natürlich haben alle Neuroleptika antidopaminerge Effekte, sodass Parkinsonismen eine häufige Nebenwirkung darstellen können. Quetiapin verursacht jedoch am wenigsten Parkinsonismus und hat darüber hinaus ein günstiges Profil, weswegen wir es am häufigsten für das Management von Verhaltensstörungen einsetzen.
Ich hoffe, damit deine Frage beantwortet zu haben. Viele Grüße
Laura.
3. Nuria Reyes Alonso äußert ihre Fragen zum Vortrag über Menschen mit Down-Syndrom:
Frage:
Welche Tests führst du durch, wenn Erwachsene im Laufe ihres Lebens kaum Stimulation hatten, keine Lese- und Schreibfähigkeiten besitzen und ihr Verständnis sehr gering ist?
Der CAMDEX-Test ist doch nur für leichte bis mittelschwere geistige Behinderung. Danke.
Antwort:
Hallo Nuria, leider ist die Situation zur Erfassung der Kognition bei schwerer geistiger Behinderung kompliziert. Ich versuche persönlich immer, den CAMDEX und sogar den CRT durchzuführen. Manchmal bringen sie gar nichts, aber manchmal ist man überrascht, was diese Patient*innen leisten können, obwohl ihr Sprachvermögen begrenzt ist.
Einerseits wirst du sehr niedrige Werte erhalten, aber sie können hilfreich sein, wenn du eine Längsschnittbeobachtung machst. Alternativ kannst du einfache Tests und Subtests aus Testbatterien verwenden, von denen du denkst, dass sie auf das Niveau der betreffenden Person angepasst werden können. Zum Beispiel: die Praxien des CAMCOG, einige Subtests des Barcelona-Tests, Kindertests oder das Haxby-Auftragsverständnis. Das dient zwar nicht unbedingt der Forschung, ist aber im klinischen Alltag wertvoll. Zudem gibt es den SIB – Severe Impairment Battery (Saxton et al., 1993). Dieser Test ist für schwere geistige Behinderung mit 40 Items konzipiert und dauert etwa 20 Minuten.
Wichtiger als die Tests selbst ist, eine sorgfältige Anamnese mit einer nahestehenden Pflegeperson durchzuführen, die den Patienten gut kennt. So erhältst du wertvolle Informationen und kannst Veränderungen treffend einschätzen. Hier bietet sich außerdem das CAMDEX-DS-Interview und die DMR-Skala an.
Mir ist bekannt, dass TEA an der Validierung eines computergestützten Tests für schwere geistige Behinderung (ECDI-SE) arbeitet, ich weiß aber nicht, in welchem Stadium dieses Projekts man sich befindet.
Ich hoffe, diese Informationen sind nützlich für dich. Viele Grüße
Laura.
4. Alicia Márquez fragt zu einem klinischen Fall im Vortrag über Menschen mit Down-Syndrom:
Frage:
Guten Tag Laura. Erst einmal vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zu deinem Vortrag. Ich würde gerne wissen, warum in klinischem Fall Nr. 2 dem Patienten Quetiapin verschrieben wurde, obwohl dieses Antipsychotikum keine Hinweise auf eine mögliche Psychose gab?
Vielen Dank im Voraus.
Antwort:
Vielen Dank für deinen Kommentar, Alicia. Ich freue mich, dass dir der Vortrag zu Menschen mit Down-Syndrom gefallen hat.
Mit dem letzten Fall wollte ich aufzeigen, dass nicht jede kognitive Beeinträchtigung bei Patient*innen mit Down-Syndrom auf eine Alzheimer-Erkrankung zurückzuführen ist. Eine sorgfältige Diagnostik ist entscheidender. Auch die Neuropsychologie unterstützt uns hierbei. Der von mir vorgestellte Patient hat eine langjährige Vorgeschichte mit Verhaltensauffälligkeiten (Aggressivität, herausforderndes Verhalten etc.), aber ich habe nicht alle Details genannt, um nicht zu ausschweifend zu werden. Er wird psychiatrisch begleitet und es wurden schon viele verschiedene Behandlungsstrategien erprobt. Quetiapin ist ein Medikament, das nachweislich Verhaltensauffälligkeiten bei Patient*innen mit Demenz verbessert. Aus unserer Erfahrung sprechen auch Menschen mit Down-Syndrom (mit und ohne Demenz) gut auf dieses Mittel an.
Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Viele Grüße
Laura.
5. Valeria Patti Gelabert stellt Fragen zur Wiederholungsevaluation bei Patient*innen mit Down-Syndrom:
Frage:
Ausgezeichneter Vortrag, vielen Dank! Ich habe eine Frage zur Reevaluation: In welchen Abständen wird sie beim Patienten durchgeführt?
Antwort:
Hallo Valeria! Danke für deinen Kommentar.
Unser Gesundheitskonzept empfiehlt ein jährliches Follow-up, sofern die Person gesund ist. Wird jedoch eine Demenz diagnostiziert, richtet sich die Frequenz nach dem Einzelfall. Allgemein gelten mindestens 6 Monate Abstand zwischen neuropsychologischen Testungen. Erfordert ein Patient engmaschigere Kontrollen, erfolgen zwischenzeitlich lediglich neurologische Visiten, und die Neuropsychologie findet dann nach 6 und/oder 12 Monaten statt.
Frage:
Welche Schwellenwerte gelten für einen demenztypischen Abbau im CAMCOG-DS-Test?
Antwort:
Bei dieser Population gibt es keine festen Cut-offs wie in der Allgemeinbevölkerung. Es fehlen auch belastbare Studien, die den Bedeutungsgrad eines Punktabfalls belegen. Daher ist es notwendig, Längsschnittuntersuchungen durchzuführen und jede Person mit ihrem Ausgangswert zu vergleichen. Dabei muss die Basismessung in einer Phase ohne Verdacht auf Demenz oder andere Ursachen für kognitive Einbußen erfolgen.
Aktuell haben wir eine Studie zum Thema Cut-offs für CAMCOG und CRT in Begutachtung, die dir vermutlich nützlich sein wird. Außerdem analysieren wir Daten, um festlegen zu können, ab welchem Testergebnisabfall eine statistisch signifikante Veränderung vorliegt. Wir hoffen auf eine baldige Veröffentlichung.
Frage:
Wird zwischen den Testungen eine kognitive Stimulation durchgeführt? Kann die Evaluierung und Reevaluierung einen Lerneffekt hervorrufen?
Antwort:
Unsere Einheit ermöglicht keine kognitiven Interventionsprogramme im Rahmen der Routineversorgung. Wir empfehlen jedoch stets, dass Personen sich aktiv halten (körperlich und mental). Stellen wir einen Mangel an Stimulation fest, veranlassen wir sozialarbeiterische Maßnahmen, um entsprechende Angebote bereitzustellen.
Frage:
Kann die Evaluierung und Reevaluierung einen Lerneffekt bewirken?
Antwort:
Es gibt keine veröffentlichten Daten, die einen Lerneffekt bei dieser Population nachweisen. Allerdings halte ich ihn für möglich, insbesondere bei leichteren Fällen. Der CRT bietet drei Versionen, um die Stimulusfolien zu variieren, und ist daher eine gute Option, um solche Effekte zu minimieren.
Ich hoffe, die Informationen sind hilfreich. Deine Fragen fand ich sehr interessant. Viele Grüße
Laura.
6. Lucía Elices García stellt Fragen zur neuropsychologischen Evaluation bei Menschen mit Down-Syndrom:
Frage:
Wenn ihr bei Personen mit Down-Syndrom kognitive und verhaltensbezogene Veränderungen beobachtet, die auf eine mögliche Demenz hindeuten und die ihr durch neuropsychologische Evaluation und nachfolgende bildgebende Verfahren bestätigt, ändert sich dann ab diesem Zeitpunkt der Interventionsprozess?
Und beginnen Sie in der Regel auch mit einer pharmakologischen Behandlung für Demenzen?
Danke.
Antwort:
Hallo Lucía, danke für deine Frage. Wie du weißt, ist die Alzheimer-Erkrankung derzeit nicht heilbar. Die verfügbaren Therapien zielen darauf ab, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen und Begleitsymptome zu behandeln. Nach Diagnose einer Demenz bei Menschen mit Down-Syndrom erhalten sie dieselben IACE-S (Acetylcholinesterase-Inhibitoren) wie die Allgemeinbevölkerung. Im weiteren Verlauf können medikamentöse Mittel zur Behandlung spezifischer Symptome wie Schlafstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten hinzugefügt werden.
In diesen Fällen erfolgt die medizinische Nachsorge in der Regel halbjährlich oder je nach Bedarf sogar alle drei Monate. Vorsicht ist bei Präparaten wie Memantin geboten, da sie die epileptische Schwelle senken und diese Population ein erhöhtes Risiko für demenzassoziierte Anfälle trägt. Ich verweise auf eine Studie von 2018 zum Einsatz von IACE-S bei Down-Syndrom und Demenz.
Darüber hinaus bieten wir den Familien nach der Diagnose stets ein Orientierungsgespräch an. Diese Termine werden von einer Neuropsychologin und einer Sozialarbeiterin durchgeführt, die Informationen zur Erkrankung und zu verfügbaren Ressourcen vermitteln. Außerdem können Angehörige an Selbsthilfegruppen teilnehmen, um Erfahrungen und Gefühle auszutauschen.
Frage:
Beginnen Sie mit einem neuen Interventionsprogramm oder erhöhen Sie zum Beispiel die Anzahl der Sitzungen zur kognitiven Stimulation?
Antwort:
Unsere Einheit erlaubt keine kognitive Trainingsintervention im Rahmen der Routineversorgung. Wir raten jedoch stets dazu, dass Personen sowohl körperlich als auch geistig aktiv bleiben. Bei erkennbarem Stimulationdefizit leiten wir sozialarbeiterische Maßnahmen ein, um entsprechende Angebote bereitzustellen.
Ich empfehle, die kognitiven Anforderungen schrittweise an den Krankheitsverlauf anzupassen. Das verhindert Frustration und fördert die noch erhaltenen Fähigkeiten. Zudem sollte die Intervention so ökologisch wie möglich gestaltet werden.
Ich hoffe, die Informationen sind hilfreich.
Laura.
7. Eva María Cubero stellt Fragen zu den neurobiologischen Aspekten im Vortrag:
Frage:
Treten die von dir beschriebenen neurobiologischen Veränderungen bei allen Menschen mit Down-Syndrom auf, unabhängig davon, ob es sich um Trisomie, Translokation oder Mosaik handelt?
Antwort:
Die neurobiologischen Veränderungen sind bei allen Menschen mit Down-Syndrom vorhanden, da das Syndrom in allen drei Fällen gleich ist. Allerdings können sie unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Allgemein sind Mosaikformen weniger betroffen.
Frage:
Welche Tests verwendet ihr zur Beurteilung des Schweregrads der Behinderung beim Down-Syndrom? Sind einige der von dir erwähnten neuropsychologischen Tests frei verfügbar?
Dieser Artikel wurde übersetzt; Link zum Originalartikel auf Spanisch:
Ponencia sobre personas con síndrome de Down – Respondiendo dudas

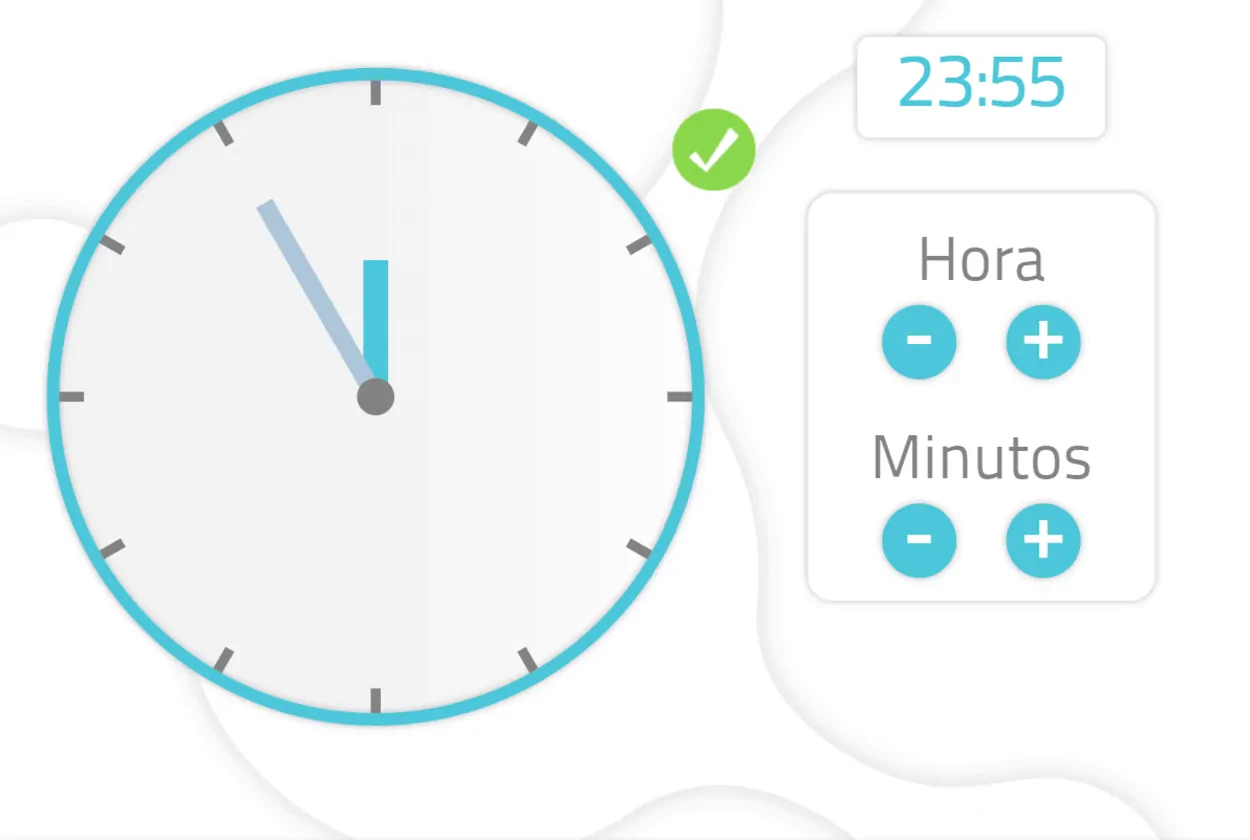
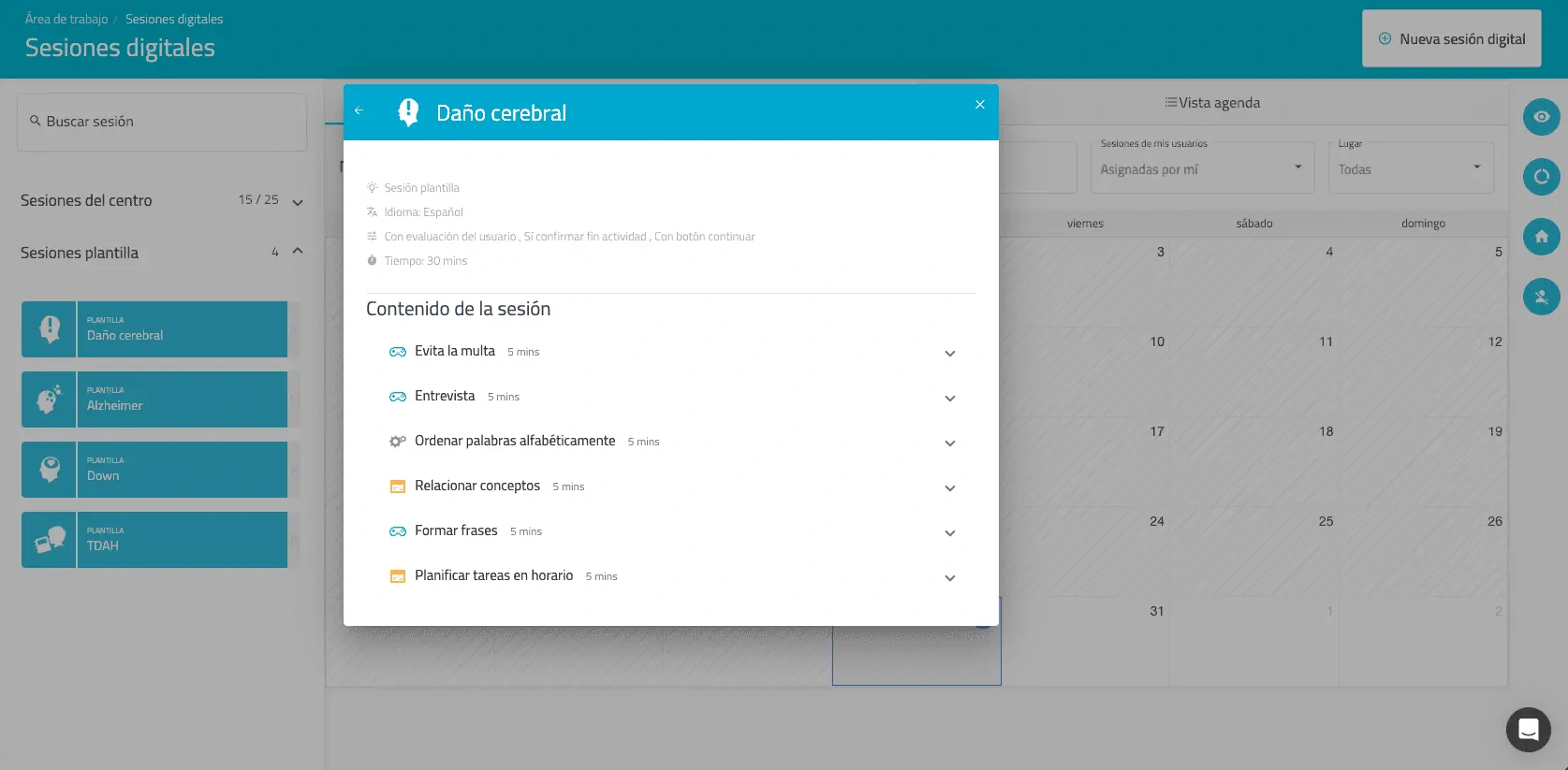
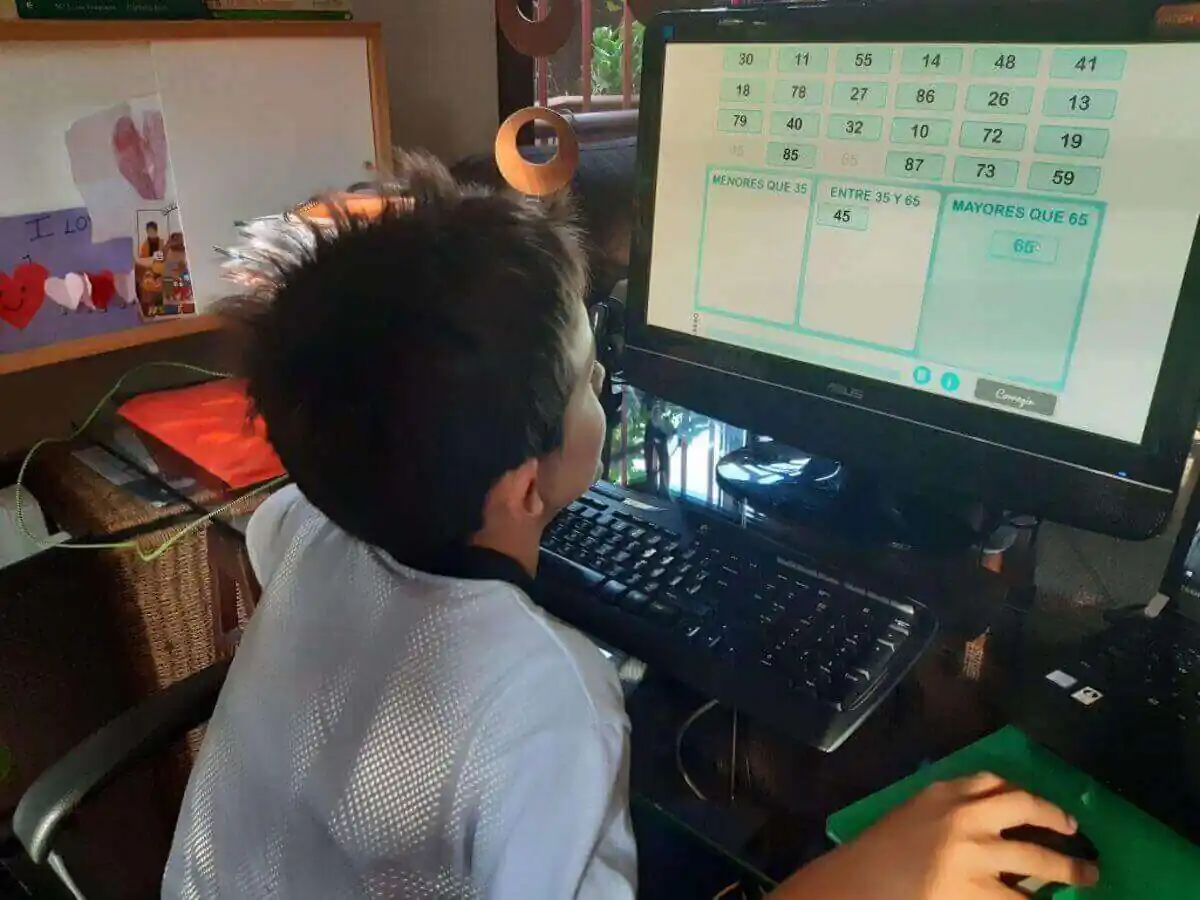

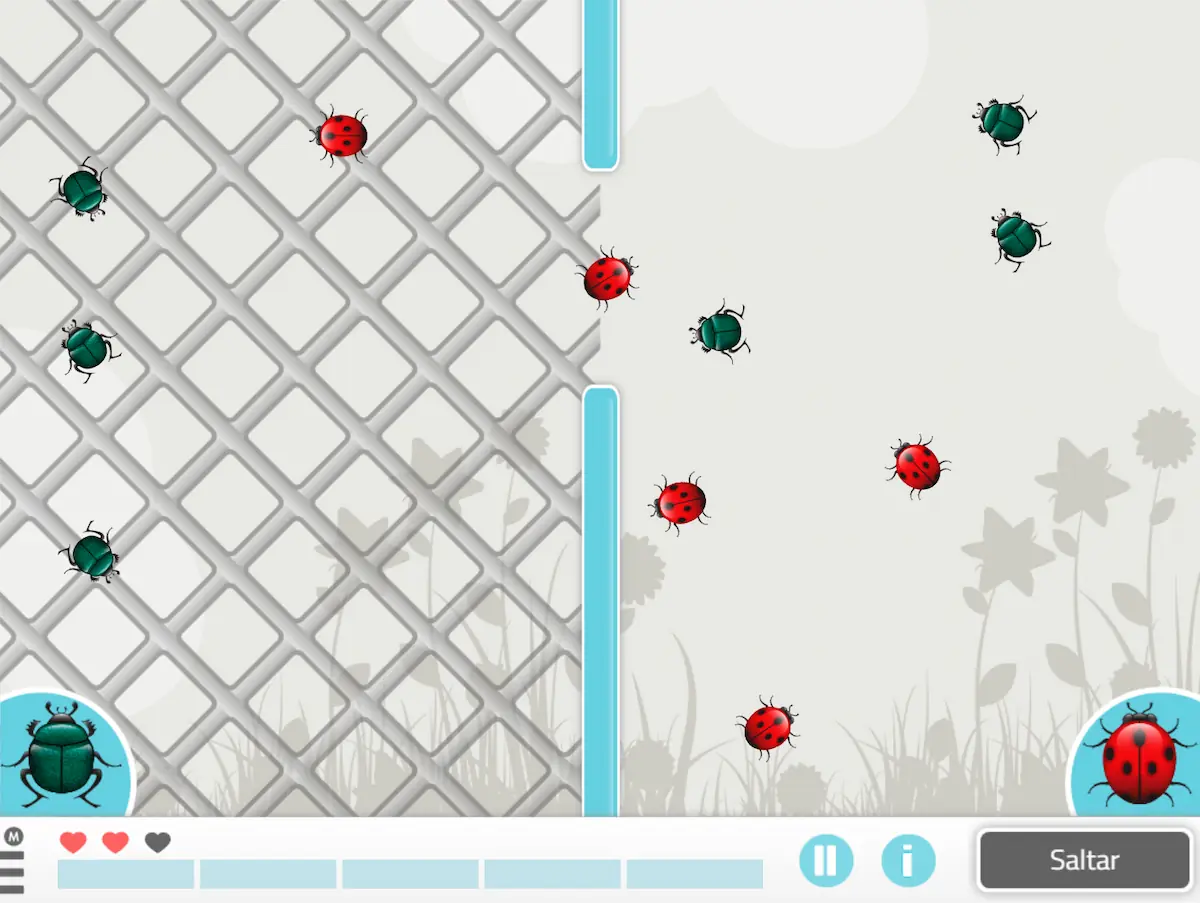
 Kognitive Stimulation in den Zentren Amunt und ihr personenzentrierter Ansatz
Kognitive Stimulation in den Zentren Amunt und ihr personenzentrierter Ansatz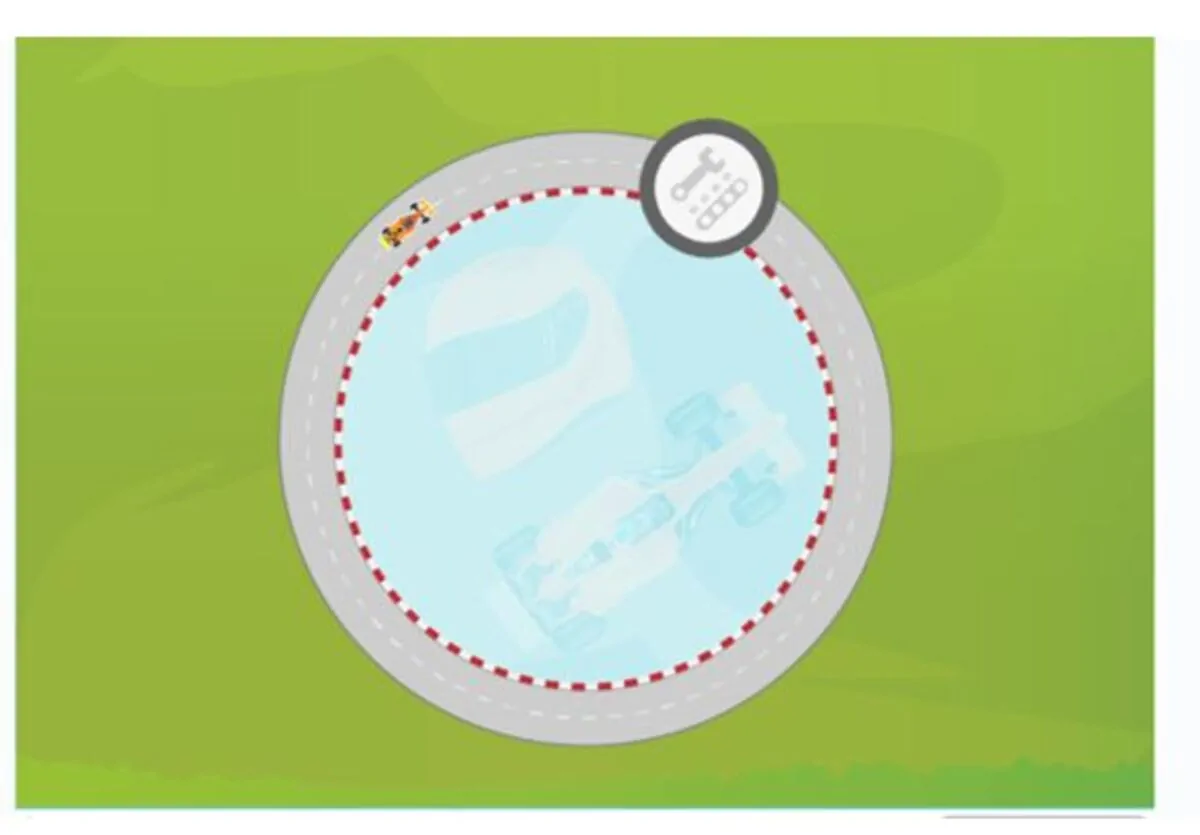
Schreiben Sie einen Kommentar