Antonio Javier Sutil präsentiert in diesem Artikel die wichtigsten Daten der Studie „Die Alzheimer-Krankheit als klinisch-biologisches Konstrukt: Empfehlung einer internationalen Arbeitsgruppe“.
Änderung der diagnostischen Kriterien für Alzheimer
Kürzlich hat die Alzheimer-Vereinigung die Änderung der diagnostischen Kriterien für Alzheimer vorgeschlagen, sodass diese ausschließlich auf biologischen Nachweisen basieren. Dies würde die Möglichkeit eröffnen, Alzheimer (AD) bei kognitiv gesunden Personen mit entsprechenden Biomarkern zu diagnostizieren. Dies könnte erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, da gleichzeitig diese neuen Kriterien nicht für kognitiv gesunde Personen empfohlen werden, was neue und bedeutende Fragen aufwirft, die geklärt werden müssen.
Dies hätte einerseits erhebliche Auswirkungen auf die Forschungsumgebungen. In den letzten Jahrzehnten haben sich die Nachweise für assoziierte Biomarker vervielfacht, was einen Paradigmenwechsel ermöglicht hat – von der postmortalen Forschung hin zur Untersuchung des Krankheitsverlaufs bereits in frühen Stadien. Dieser Wandel hat nicht nur die Zunahme der Beobachtungsforschung begünstigt, sondern auch klinische Studien vorangetrieben, wodurch eine dynamische In-vivo-Überwachung ermöglicht wird.
Andererseits hätte dies auch Auswirkungen auf klinische Umgebungen, in denen der Einsatz von Biomarkern als besonders relevant angesehen wird, da diese Informationen über pathologische Schäden oder den neurodegenerativen Prozess liefern können.
Biomarker bei Alzheimer
Allerdings wären die Hauptbiomarker allein nicht ausreichend, um alle zugrunde liegenden Mechanismen der Krankheit zu erklären. Insbesondere in klinischen Umgebungen würden Biomarker wie Tau oder Amyloid zur Unterstützung oder Widerlegung eines klinischen Verdachts auf eine Diagnose dienen. Dies ist auf die große Heterogenität der Fälle zurückzuführen.
Beispielsweise wurden postmortale Studien dokumentiert, in denen das Gehirn der untersuchten Person Läsionen aufwies, obwohl sie zu Lebzeiten keine kognitive oder funktionale Beeinträchtigung zeigte. Darüber hinaus könnte die Entdeckung neuer Biomarker aufgrund der hohen Prävalenz von Komorbiditäten zwischen neurodegenerativen Erkrankungen eher verwirren als Klarheit schaffen. Dies liegt daran, dass laut der neuen Kriterien die Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Biomarker zur gleichzeitigen Diagnose mehrerer neurodegenerativer Erkrankungen bei einer kognitiv normalen Person führen.
Diese Studie argumentiert, dass der Einfluss von Biomarkern vom Kontext abhängen würde, da sie allein nicht ausreichen, um die Krankheit zu bestimmen. Es wird vorgeschlagen, dass die Bedeutung der Biomarker mit der klinischen Perspektive kombiniert werden sollte, insbesondere um zu bewerten, ob Individuen kognitive Beeinträchtigungen aufweisen.
Folglich wird in dieser überarbeiteten Arbeit vorgeschlagen, die von der Alzheimer-Vereinigung empfohlene Definition zu überdenken. Außerdem wird eine alternative Definition basierend auf einem klinisch-biologischen Konstrukt vorgeschlagen, das die vorhandenen Erkenntnisse über Biomarker präziser einbezieht.
Die möglichen Fälle
Um die hier vertretene Perspektive genauer darzustellen, werden drei mögliche Fälle von positiven Biomarkern betrachtet und Empfehlungen für die Interpretation jeder Situation gegeben.
Asymptomatisch mit Alzheimer-Risiko (AR)
Dieser Begriff bezeichnet kognitiv normale Personen, die aufgrund eines spezifischen Biomarker-Profils ein erhöhtes Risiko für eine kognitive Beeinträchtigung aufweisen. Dieses Progressionsrisiko ist höher als bei Personen ohne Biomarker. Dieser Fall würde jedoch nicht als Alzheimer betrachtet, da er kein eindeutiger Indikator für eine zukünftige Krankheitsentwicklung ist.
Assoziiertes Biomarker-Profil: Zerebrale Amyloidose, entweder isoliert oder in Verbindung mit einer Tauopathie, die auf die medialen Temporallappen beschränkt ist, oder ein positiver phosphorylierter Tau-Biomarker (p-Tau) in Körperflüssigkeiten.
Präsymptomatisches Alzheimer (PA)
Dieser Begriff bezeichnet kognitiv normale Personen, die ein spezifisches Biomarker-Muster aufweisen, das mit einem sehr hohen, nahezu deterministischen Progressionsrisiko verbunden ist. Diese Untergruppe könnte durch zukünftige Studien, die weitere Biomarker identifizieren, neu definiert werden.
Beispiele für Biomarker-Profile, die mit diesem Fall assoziiert sind:
- Hochpenetrante autosomal-dominante genetische Varianten mit einem nahezu 100%igen Risiko, im Laufe des Lebens eine klinische Alzheimer-Erkrankung zu entwickeln: APP, PSEN1, PSEN2.
- Personen mit Down-Syndrom.
- Individuen, die homozygot für das APOE e4-Allel sind und gleichzeitig einen Funktionsverlust von SORL1 aufweisen. Bei diesen Profilen sind das Alter und das elterliche Alter zusätzliche Faktoren, die bei der Bestimmung des Krankheitsbeginns berücksichtigt werden müssen.
- Veränderungen bei sporadischen AD-Biomarkern (± genetische Vorgeschichte), die mit einem sehr hohen lebenslangen Risiko für eine klinische Alzheimer-Erkrankung verbunden sind, wie die Kombination eines positiven Amyloid-PETs und eines positiven Tau-PETs in neokortikalen Regionen.
Alzheimer-Krankheit (AD)
Dies bezieht sich auf Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen, die festgelegte Kriterien erfüllen. Sie können sich entweder in einem Stadium mit Funktionsverlust (Demenz) oder in einem prodromalen Stadium befinden, in dem die Funktionalität noch erhalten ist.
Die festgelegten Kriterien sind:
- Spezifische klinische Phänotypen: häufige (hippocampale amnestische Syndrome, logopenische Aphasie, posteriore kortikale Atrophie) oder seltene (kortikobasales Syndrom, Verhaltens- und dysexekutive Varianten).
- Positive pathophysiologische AD-Biomarker in der Rückenmarksflüssigkeit oder durch PET. Plasmatische Biomarker wie p-tau 217 könnten bald Teil der routinemäßigen klinischen Bewertung werden.

Melden Sie sich
für unseren
Newsletter an
Zusammenfassung der Unterschiede zwischen den beiden Vorschlägen
| Alzheimer Association | International Working Group | |
| Definition der Alzheimer-Krankheit | Basierend auf Biologie. | Basierend auf klinischen und biologischen Kriterien. |
| Klinische Diagnose | Das Vorhandensein eines grundlegenden Biomarkers ist erforderlich. | Ein Biomarker und ein objektiv festgestellter kognitiver Defizit sind erforderlich. |
| Beispiel | Eine Person mit normaler Kognition und einem grundlegenden Biomarker wird als AD diagnostiziert. | Eine Person mit normaler Kognition und einem grundlegenden Biomarker wird als gefährdet für AD betrachtet. |
Die Erklärung für diese Klassifizierung basiert auf der Pathophysiologie der Amyloid-Kaskade. Dies ist ein probabilistisches Modell, das unterschiedliche Einflussstufen in Abhängigkeit vom APOEε4-Gen sowie anderen Umweltfaktoren und Pathologien postuliert.
In diesem Modell werden Träger dieses Gens als Personen mit Risiko identifiziert, und es wird vorgeschlagen, dass die Progression zur kognitiven Beeinträchtigung mit den anderen genannten Faktoren zusammenhängt. Diese Risikopersonen sollten in Langzeitkohorten beobachtet werden, um Faktoren zu identifizieren, die die Progression zur Demenz beeinflussen könnten. Andererseits könnten bereits betroffene Personen identifiziert werden, die sich auf dem Weg zur Demenz befinden.
Auswirkungen auf die Gesellschaft
Die auf Biomarkern basierenden diagnostischen Kriterien für Alzheimer könnten erhebliche soziale, politische und wirtschaftliche Auswirkungen haben. Diese Studie unterstützt eine klinisch-biologische Sichtweise, da die Einstufung positiver Biomarker als Alzheimer oder asymptomatische Risikofaktoren die Strategien beeinflussen wird, die von Institutionen und Einzelpersonen ergriffen werden. Die Art der Kommunikation dieser Ergebnisse wird für die Erfahrung der Patienten entscheidend sein.
Eine kognitiv normale Person mit positiven Amyloid-Biomarkern könnte als krank eingestuft werden, obwohl diese Risikopersonen möglicherweise niemals eine kognitive Beeinträchtigung entwickeln.
Ein klares Beispiel zeigt sich in der Medikamenteneinnahme. Zum Beispiel eine Person, die mit Gantenerumab beginnt, einem Medikament zur Amyloid-Entfernung, dessen klinische Wirksamkeit jedoch nicht bewiesen ist.
Wäre es für diese Person von Vorteil, über Jahre hinweg Medikamente einzunehmen, ohne sicher zu sein, dass die Krankheit fortschreitet, oder ohne Gewissheit, dass dieses Medikament kognitive und verhaltensbezogene Aspekte beeinflusst?
Darüber hinaus sollte das potenzielle Risiko einer Fehldiagnose berücksichtigt werden, da proteinbasierte Biomarker, wie in diesem Fall, keine deterministische Unterscheidung wie genetische Marker ermöglichen, sondern nur eine probabilistische. Dies ist besonders relevant, wenn man bedenkt, dass es zu erheblichen Unterschieden zwischen Regionen wie Nordamerika und Europa kommen könnte.
Ein Beispiel für die Auswirkungen wäre die Diagnose eines Patienten, der seinen Arzt wegen harmloser Gedächtnisbeschwerden infolge anderer Erkrankungen oder des Alters aufsucht und aufgrund positiver Biomarker ein falsch positives Ergebnis erhält. Dieses Risiko würde noch steigen, wenn solche Tests direkt an Verbraucher verkauft würden, ohne dass ein Arzt beteiligt wäre. Dies könnte zu einem Anstieg der Diagnosen bei kognitiv normalen Personen und folglich zu einer erhöhten Einnahme von Medikamenten zur Vorbeugung kognitiver Beeinträchtigungen führen.
Die Kriterien der Alzheimer Association befürworten den Einsatz von Biomarkern bei kognitiv normalen Personen nicht. Allerdings wäre es wenig realistisch, den Zugang zur Alzheimer-Diagnose und zur Behandlung zu kontrollieren, wenn diese allein auf Biomarkern basiert. Daher muss eine klarere Botschaft zu diesem Thema vermittelt werden.
Schlussfolgerungen und Relevanz
Die International Working Group definiert die Alzheimer-Krankheit als eine klinisch-biologische Entität. Die klinische Diagnose von Alzheimer erfolgt bei Vorliegen eines etablierten klinischen Phänotyps sowie physiopathologischer Biomarker, die auf eine Alzheimer-Pathologie (AD) hinweisen. Dies umfasst sowohl prodromale Phasen (vor der Demenz) als auch die Demenzstadien, da diese Phasen als Teil des Krankheitskontinuums betrachtet werden.
Die International Working Group rät davon ab, Biomarker zur Diagnose von Alzheimer bei kognitiv normalen Personen zu verwenden, selbst wenn subjektive Beschwerden vorliegen. Stattdessen empfiehlt sie, diese Biomarker für die Forschung zur Bewertung zukünftiger Risiken zu nutzen, um diese Risiken zu kommunizieren und präventive Strategien zu entwickeln.
Die Untersuchung kognitiv normaler Personen mit positiven Biomarkern ist entscheidend für die Entwicklung prädiktiver Algorithmen und die Einschätzung des Progressionsrisikos. Aus dieser Perspektive würde nur eine kleine Gruppe aufgrund genetischer Varianten oder Hochrisiko-Biomarker-Profile als präsymptomatisch eingestuft werden, während der Rest als asymptomatisch mit Risiko klassifiziert werden sollte.
Zukünftige Forschungen sollten sich auf kognitiv normale Personen konzentrieren:
- Einerseits durch langfristige Beobachtungsstudien, um Biomarker und Lebensstil-Risikofaktoren gleichzeitig zu analysieren.
- Andererseits durch klinische Interventionsstudien zur Bewertung der Wirksamkeit von pharmakologischen Behandlungen und anderen Strategien gegen Alzheimer.
Autoren
Diese Arbeit ist das Ergebnis einer internationalen Zusammenarbeit mit mehr als 40 Autoren. Zu den Hauptautoren gehört Bruno Dubois, Professor der Neurologieabteilung des Salpêtrière-Krankenhauses und der Sorbonne-Universität in Paris. Derzeit ist er assoziierter Forscher der FrontLab-Gruppe am Paris Brain Institute, wo er zuvor als leitender Forscher tätig war. Die FrontLab-Gruppe untersucht den präfrontalen Kortex als eine zentrale Region für höhere kognitive Funktionen sowohl im gesunden als auch im krankhaften Zustand. Darüber hinaus hat Professor Dubois zahlreiche Studien zu subkortikalen Erkrankungen und Demenz veröffentlicht und ist einer der Hauptorganisatoren der Expertengruppe, die an den neuen diagnostischen Kriterien für Alzheimer arbeitet.
Bibliografie
- Dubois B, Villain N, Schneider L, et al. Alzheimer Disease as a Clinical-Biological Construct—An International Working Group Recommendation. JAMA Neurol. Published online November 01, 2024. doi:10.1001/jamaneurol.2024.3770



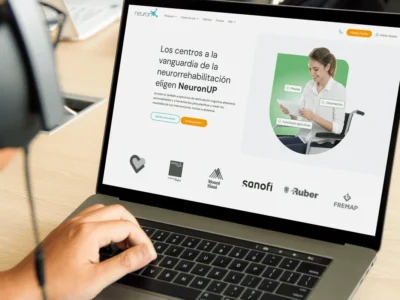


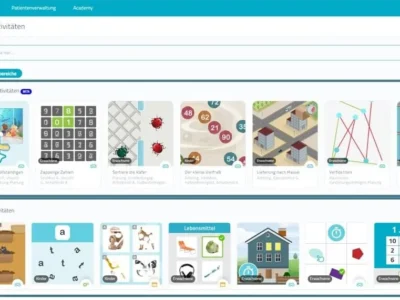
 Neurochirurgie im Wachzustand bei Hirntumoren: Verfahren, Vorteile und Fortschritte
Neurochirurgie im Wachzustand bei Hirntumoren: Verfahren, Vorteile und Fortschritte
Schreiben Sie einen Kommentar