Der Ergotherapeut Ángel Sánchez spricht heute, nachdem er in einem früheren Beitrag die Ziele und Funktionen der Ergotherapie erläutert hat, über die Tätigkeit der Ergotherapie bei Patienten mit erworbenem Hirnschaden.
Ergotherapie ist die zielgerichtete Anwendung von Aktivitäten oder Interventionen, die darauf ausgelegt sind, funktionale Ziele zu erreichen, die Gesundheit zu fördern, Krankheit vorzubeugen und die Verbesserung, Aufrechterhaltung oder Wiedererlangung des höchstmöglichen Unabhängigkeitsgrades für jede Person zu entwickeln, die eine Verletzung, Krankheit oder andere Schwierigkeiten erlitten hat – in diesem Fall bei Patienten mit erworbenem Hirnschaden (EHS).
Einführung
Das Hauptziel der Ergotherapie besteht darin, den Einzelnen zu befähigen, die für ihn im Leben wesentlichen Aktivitäten durchführen zu können. Der Ergotherapeut bewertet die motorischen, kognitiven, perzeptiven und zwischenmenschlichen Fähigkeiten, die den Aktivitäten des täglichen Lebens sowie den individuellen Betätigungen und Rollen zugrunde liegen. Abhängig vom Potenzial der Person für ihre Genesung erleichtert er die Ausführung von Aktivitäten durch Verbesserung der Fähigkeiten, Schulung und Entwicklung kompensatorischer und rehabilitativer Strategien, um die persönliche Unabhängigkeit zu erhalten.
Diese Intervention ist durch einige Merkmale gekennzeichnet, die der professionellen Praxis der Ergotherapie eigen sind, darunter:
- Den Patienten mit erworbenem Hirnschaden dazu befähigen, in seinen Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) selbstständig zu sein.
- Neue Rollen und bedeutungsvolle Aktivitäten für den Patienten festlegen.
- Strategien bereitstellen, die die Generalisation des Gelernten vom klinischen Bereich in den Alltag erleichtern.
- Analyse, Auswahl und Ausarbeitung von Aktivitäten als therapeutischen Interventionsprozess nutzen, um zur Erreichung der für den Patienten relevanten Ziele beizutragen.
Der erworbene Hirnschaden bezeichnet eine Patientengruppe, deren gemeinsames Merkmal ein Ereignis ist, das ihre lebenslange Entwicklung unterbrochen hat. Innerhalb dieser heterogenen Gruppe sind Schlaganfallpatienten und Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma am häufigsten, jedoch finden sich auch solche mit Hirntumoren, Verletzungen, Enzephalitis und vielfältigen Ursachen zerebraler Anoxie (Apnoe, Vergiftungen, Herzinfarkte etc.). Verkehrsunfälle, Arbeits- oder Sportunfälle, die steigende Lebenserwartung und die verbesserte akute Versorgung dieser Patienten tragen zur Zunahme ihrer Morbidität bei.

Melden Sie sich
für unseren
Newsletter an
Hauptdefizite
Es ist schwierig, nach einem EHS ein allgemeines Muster der Beeinträchtigung festzulegen, da die festgestellten Störungen von verschiedenen Faktoren abhängen, vor allem von der anfänglichen Schwere der Verletzung, deren Art und Lokalisation sowie dem Vorhandensein von Komplikationen in der akuten Phase, nicht zu vergessen weitere relevante Faktoren wie Alter, Persönlichkeit und kognitive Fähigkeiten vor dem Unfall.
Zu den Hauptdefiziten zählen sensomotorische Störungen (Störungen des Muskeltonus, der Koordination und motorischen Kontrolle, verminderte Oberflächen- und Tiefensensibilität), Sprach- und Kommunikationsprobleme (verschiedene Formen der Aphasie, Dysarthrie, Störungen der verbalen Flüssigkeit und der pragmatischen Kommunikationsfähigkeit) und neuropsychologische Störungen (kognitive und Verhaltensstörungen).
Diese Störungen sollten nicht isoliert betrachtet werden, sondern mit besonderem Augenmerk auf die Schwierigkeiten, die sie bei der Durchführung der ADL verursachen.
Aktivitäten des täglichen Lebens
ADL umfassen die täglichen Betätigungen, die eine Person entsprechend ihrer biologischen, emotionalen, kognitiven, sozialen und beruflichen Rolle ausführt, und wir unterscheiden dabei:
- Basis-ADL: Grundlegende und notwendige Selbstfürsorgefertigkeiten wie Ernährung, Körperpflege, Ankleiden, Kontinenzkontrolle, Mobilität und Transfers.
- Instrumentelle ADL: Komplexere Tätigkeiten, die eine größere Planung erfordern und die Fähigkeit der Person anzeigen, in ihrer Gemeinschaft unabhängig zu leben. Dazu gehören: Einkaufen, Umgang mit Geld, Zubereitung von Speisen, Autofahren, Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel etc.
Das Grundziel der Ergotherapie besteht darin, den Einzelnen zu befähigen, bedeutungsvolle Aktivitäten innerhalb seiner persönlichen Rollen so unabhängig wie möglich auszuführen. Traditionell wird die Intervention bei dieser Patientengruppe in zwei Modelle unterteilt:
- Das Wiederherstellungsmodell, das auf der Restaurierung der physischen, kognitiven und perzeptiven Fähigkeiten basiert.
- Das Anpassungs- oder Funktionsmodell, das den Einsatz der vom Individuum erhaltenen Fähigkeiten betont, um Defizite zu kompensieren.
Beschreibung der Modelle
Das Behandlungsprinzip des Wiederherstellungsmodells verwendet Aktivitäten, die eine kortikale Informationsverarbeitung erfordern und sich auf die Stimulation der betroffenen Funktion konzentrieren, um neue neuronale Verbindungen zu erzeugen. Dabei werden insbesondere Aufgaben eingesetzt, deren Ziel die Analyse der betroffenen Fähigkeiten zur Informationsverarbeitung ist. Implizit geht dieses Modell davon aus, dass der Patient, sobald die Funktion wiederhergestellt ist, dieses Lernen auf beliebige Kontexte und Situationen übertragen kann.
Das Anpassungs- oder Funktionsmodell basiert auf der Idee, dass das Gehirn die Fähigkeit zur Reorganisation besitzt und bis zu einem gewissen Grad seine Informationsverarbeitungsfähigkeit wiedererlangen kann. So hilft es der Person, ihr verbleibendes Potenzial zu priorisieren und Strategien zu nutzen, um Einschränkungen zu kompensieren.
Bewertung und Behandlung
Bewertung und Behandlung basieren auf der Funktionalität (ADL), das heißt darauf, was der Patient kann oder nicht kann. Außerdem wird das Bewusstsein des Individuums für seine physischen, kognitiven und perzeptiven Grenzen betont, um eine interne Kompensation zu ermöglichen. Ebenso wird anerkannt, dass die Entwicklung erfolgt, wenn Umgebung oder Aufgabe den Eigenschaften der Person angepasst werden (externe Kompensation).
Es ist auch wichtig, ein reflexives Modell in der Betreuung von Hirnschaden zu berücksichtigen, bei dem die Entscheidungsfindung auf klinischem Denken und verfügbarer wissenschaftlicher Evidenz basiert, um Perspektiven im Umgang mit dem Patienten zu bieten. So soll die Entscheidungsfindung den Bedürfnissen des Nutzers entsprechen, indem zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung geeignete therapeutische Strategien ausgewählt und der Rehabilitationsprozess gemeinschaftlich festgelegt wird.
Aktivitätsbasierte Intervention
Die Ergotherapie ermöglicht Lernen und Wiederherstellung durch Modifikation von Umweltreizen, in der Art der Darbietung der Betätigungsaufgaben und in der Veränderung des Kontexts, in dem sie stattfinden. Daher stützt sie ihre Intervention auf die Aktivität, aus folgenden Gründen:
- Sie ist die Art, das Potenzial jedes Patienten zu maximieren, um Defizite infolge der Verletzung zu verbessern und mögliche daraus resultierende Behinderungen vorzubeugen.
- Minimiert soweit wie möglich Abhängigkeitsprozesse, indem es den Einzelnen befähigt, relevante Aktivitäten entsprechend seinen persönlichen Rollen zu entwickeln.
- Reduziert Einschränkungen in der Teilhabe, indem es den Erwerb neuer Rollen erleichtert und den Rehabilitationsprozess so ganzheitlich wie möglich angeht, wobei stets die Vorlieben und Präferenzen des Patienten berücksichtigt werden.
- Stimuliert und erleichtert die Generalisierung von Lerninhalten, indem die Rehabilitation so ökologisch wie möglich gestaltet wird, das heißt durch Alltagsaktivitäten in realen Kontexten. Dies macht die Ergotherapie zu einer der geeignetsten Disziplinen für die Behandlung dieser Patientengruppe, da es sichert, dass das Lernen und seine Anwendung effektiv erfolgen.
Aktivität und kognitive Funktionen
Übung, verstanden als die Wiederholung isolierter Bewegungen oder kognitiver Funktionen, weicht zunehmend Gelegenheiten in funktionalen Aktivitäten in verschiedenen Kontexten. Die Ergotherapie nutzt dieses Wissen, um die Bedingungen der professionellen Praxis so zu strukturieren, dass sie sich auf die Bestimmung der notwendigen Bedingungen in der Lernphase konzentriert, um die Beibehaltung und den Transfer des Gelernten durch den Patienten zu optimieren.
Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass die Fähigkeiten, die zur Durchführung einer „realen“ Aktivität erforderlich sind, nicht in von der Realität losgelösten Kontexten oder durch ausschließlich repetitive Übungen erworben werden können.
Der Ergotherapeut verändert die Umwelt, um die für therapeutische Zwecke zu bearbeitenden motorischen oder kognitiven Verhaltensweisen und Strategien zu stimulieren. Zu betonen ist, dass neueste Erkenntnisse die Wirksamkeit der Aktivität als therapeutisches Mittel gegenüber Programmen mit isolierten, repetitiven Übungen aufzeigen.
Das grundlegende Instrument der Ergotherapie
Das grundlegende Instrument der Ergotherapie ist die Aktivitätsanalyse, bei der bestimmt und ausgewählt wird, welche Aufgaben entsprechend den Eigenschaften des Patienten für die therapeutischen Zwecke nützlich sind. Ihre Anwendung hat drei allgemeine Funktionen:
- Bewertung der ADL
- Beurteilungsinstrument für Fähigkeiten: motorisch, kognitiv, verhaltensbezogen etc.
- Therapieziele
Diese Ziele ergänzen die allgemeine Zusammenfassung des ganzheitlichen Verständnisses der Situation des Patienten in Bezug auf seine persönlichen Interessen, Rollen und vorhandenen Fähigkeiten nach der Verletzung, um anschließend die zielgerichteten Aktivitäten als Behandlungsmodus festzulegen.
Individualisierte Behandlung
Bezieht man sich auf die Fähigkeiten des Patienten, bewertet der Ergotherapeut die ADL im Kontext ihrer Durchführung, um die erforderlichen Komponenten zu bestimmen und mit den vom Patienten nach dem Hirnschaden verfügbaren Fertigkeiten zu vergleichen. Dies ermöglicht die Erstellung eines individualisierten Behandlungsplans, der darauf abzielt, verbesserungsfähige Defizite zu beheben und zu kompensieren sowie geeignete Leitlinien für den Umgang mit dem Patienten festzulegen.
Diese Analyse umfasst aus sensomotorischer Perspektive das geeignete „posturale Set“ für eine alltägliche Aktivität sowie die Strukturierung ihrer kognitiven Komponenten und die kontextuellen Variablen, die ihre Durchführung beeinflussen können.
Der Einsatz von Aktivität in der Ergotherapie unterscheidet sich von der Nutzung durch andere Fachkräfte in:
- Es verfolgt ein doppeltes Ziel. Einerseits die angemessene Ausführung einer Aktivität aus der Sicht des Patienten unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, Umfeld und Interessen; andererseits die Verbesserung der Defizite des Patienten durch Stimulation ihrer Erholung.
- Die Fähigkeit des Ergotherapeuten, ausgewählte Aspekte und kontextuelle Bedingungen der Aktivität anzupassen. Dadurch ist die Anpassung des Materials, der Darbietungsform, Größe, Gewicht, Textur, Reihenfolge, Normen und Verfahren zur Durchführung der Aktivität ein grundlegendes Merkmal der Behandlung in der Ergotherapie.
- Der Ergotherapeut agiert als Facilitator bei der Durchführung der Aufgabe. Diese Funktion kann auf vielfältige Weise erfolgen: durch Positionierung des Patienten vor Beginn, Dehnung bestimmter Muskelgruppen, die in der Aufgabe aktiv benötigt werden, Einsatz relevanter visueller oder verbaler Stimuli, geführte Bewegungen, Verwendung orthoprotetischer Vorrichtungen etc. Diese Stimuli werden graduell in ihrer Schwierigkeit gesteigert, bis der Patient die Anforderungen ohne Hilfe erfolgreich bewältigen kann. Ebenso spielt der Ergotherapeut in den frühen Phasen des Lernprozesses eine entscheidende Rolle, um die Entwicklung unerwünschter kompensatorischer Strategien und damit verbundener sekundärer Defizite zu verhindern.
- Die Auswahl der Aktivität ist einzigartig für jeden Patienten und nimmt den Patienten mit EHS als individuell und verschieden von allen anderen Patienten seiner Pathologie wahr.

Melden Sie sich
für unseren
Newsletter an
Ziele der therapeutischen Betätigung
Die therapeutische Betätigung wird mit zwei Zielen eingesetzt:
- Die Betätigung als Ziel ist definitionsgemäß zielgerichtet. Der richtungsweisende Charakter der Betätigung als Ziel zeigt sich in ihrer Fähigkeit, das Verhalten der Menschen, den Alltag und das Leben zu organisieren. Sie ist nicht nur zielgerichtet, sondern auch bedeutungsvoll. Die Durchführung von Aktivitäten oder Aufgaben, die eine Person ausführt, steht in Beziehung zur Bedeutung, die sie ihnen beimisst. Nur Aktivitäten, die für die Betroffenen bedeutungsvoll sind, bleiben in ihrem gewohnten Verhaltensrepertoire erhalten.
- Die Betätigung als Mittel bezieht sich auf ihre Funktion als Veränderungsagent, um Defizite in den Fähigkeiten oder Kapazitäten der Person zu beheben. In diesem Sinne ist Betätigung gleichbedeutend mit dem Konzept der „zielgerichteten Aktivität“. Eine zielgerichtete Aktivität erfordert spezifischere und individuellere Antworten als die Betätigung als Ziel.
Was macht die Betätigung als Mittel therapeutisch?
- Die Aktivität muss einen Zweck oder ein Ziel haben, das einen Änderungsbedarf fordert und den Erfolg ermöglicht.
- Sie muss für die Person, die den Wandel durchführt, bedeutsam und relevant sein, da dies das Lernen und die Verbesserung motiviert.
Daher liegt der therapeutische Aspekt der als Mittel eingesetzten Betätigung in ihrem zielgerichteten und bedeutungsvollen Charakter.
Er basiert auf der Prämisse, dass die Aktivität selbst therapeutische Eigenschaften aufweist, die organische Veränderungen oder Verbesserungen verhaltensbezogener Defizite bewirken. Allerdings sind diese inhärenten Aspekte in der Analyse der während des Ergotherapieprozesses durchgeführten Aktivität nicht leicht zu identifizieren.
Während die bedeutungsvolle Betätigung per se einen Zweck hat, könnte eine zielgerichtete Aktivität streng genommen bedeutungsvoll sein oder nicht. Der Zweck einer Aktivität ist das Ziel, also das erwartete Endergebnis. Die Bedeutung ist der Wert, den sie für die Person hat und der das Ziel ergänzt. Sie ist daher ein individuelles Element, das von den Überzeugungen, Präferenzen, dem Kontext und der Kultur sowie den Erwartungen des Patienten an seinen Genesungsprozess abhängt.
Während des Therapieverlaufs entwickelt sich die Bedeutung durch den persönlichen Austausch zwischen Patient und Therapeut, um den Aktivitäten in einem kulturellen Kontext, zu einem bestimmten Zeitpunkt und im Hinblick auf Erfahrungen und Behinderung Bedeutung zu verleihen, und dabei die gegenwärtigen Bedürfnisse zu berücksichtigen.
Hauptziele der ergotherapeutischen Intervention bei Patienten mit erworbenem Hirnschaden
Im Folgenden werden einige der Hauptziele der ergotherapeutischen Intervention bei Patienten mit EHS allgemein beschrieben:
Korrekte Körperachsen-Ausrichtung
Die Schwäche bestimmter Muskelgruppen und der Verlust der motorischen Kontrolle über die zur Haltungsausgleich erforderlichen Anpassungen in Extremitäten und Rumpf sind die Hauptveränderungen, die nach einem EHS auftreten. Daher wird die Vorbeugung und Behandlung muskuloskelettaler Sekundärveränderungen durch korrekte Körperachsen-Ausrichtung in den verschiedenen Positionen, in denen der Patient seine Alltagsaktivitäten (Liegend, Sitzen, Stehen) ausführt, erworben. Außerdem ist die Bedeutung der richtigen Lagerung des Patienten in den frühen Phasen nach dem Hirnschaden (Lagerungssysteme) sowie die erforderliche Durchführung verschiedener motorischer Aufgaben hervorzuheben.
Bewertung und Wiederherstellung der Körperachsen-Ausrichtung
Der Patient mit Hirnschaden weist häufig eine verminderte Fähigkeit auf, bestimmte Muskelketten effektiv mit bestimmten Handlungen zu verknüpfen (z. B. einen Löffel beim Essen zu benutzen). Dies kann auf eine Störung des Muskeltonus der beteiligten Strukturen, eine fehlende Gelenkausrichtung oder das Fehlen des für die Bewegungserledigung notwendigen motorischen Engramms zurückzuführen sein. Die Aufgabe der Ergotherapie auf dieser Ebene besteht im Wesentlichen in der angemessenen Bewertung der betroffenen Elemente, der Wiederherstellung der Körperachsen-Ausrichtung und der Förderung der geeigneten muskulären Ketten, um ADL erfolgreich durchführen zu können.
Förderung der Metakognition des Patienten
Die Ergotherapie sollte die Metakognition des Patienten fördern, insbesondere in den frühen Phasen der Bewusstwerdung der eigenen Erkrankung, indem sie die vorhandenen Defizite hervorhebt, damit der Patient die Schwierigkeiten, denen er bei einer bestimmten Aktivität begegnen wird, vorhersehen, die möglichen Ergebnisse einschätzen und seine Ausführung danach beurteilen kann.
Anschließend vermittelt sie dem Patienten allgemeine Strategien, die in verschiedenen Kontexten angewendet werden können. Zum Beispiel kann das Sammeln relevanter Informationen vor einer Aufgabe, wie etwa die Zubereitung eines Kaffees, als Strategie dienen, die den Patienten bei der Überwachung und Planung der motorischen Ausführung und der möglichen Schwierigkeiten unterstützt. Ebenso erleichtern wir seine Planung und Durchführung.
Kognitive Strategien
Ähnlich wie muskuläre Ketten und Körperachsen-Ausrichtung die Grundlage für das korrekte motorische Funktionieren bilden, bieten kognitive Strategien den geeigneten Bezugsrahmen, um die Fähigkeit des Patienten zu fördern, komplexe Informationen aus verschiedenen Situationen und Kontexten zu interpretieren und zu verarbeiten. Diese Strategien zielen darauf ab, dass die Person in der Lage ist, relevante Informationen aus dem Umfeld und der Aktivität auszuwählen und unwichtige Informationen auszuschließen, die die korrekte Informationsverarbeitung stören könnten, um so das passende Verhalten (motorisch, sensorisch usw.) zu planen.
Ebenfalls darf nicht vergessen werden, insbesondere bei erworbenem Hirnschaden, dass die Durchführung einer ADL stets die Einbeziehung und Integration verschiedener Voraussetzungen oder Grundkomponenten auf sensomotorischer, kognitiver und verhaltensbezogener Ebene erfordert, deren Störungen in direktem Zusammenhang mit funktionellen Einschränkungen und deren Auswirkungen auf die Ausführung der ADL stehen.
Bedarfsermittlung
Zu den Aufgaben des Ergotherapeuten gehört auch die Bedarfsermittlung hinsichtlich technischer Hilfsmittel oder Unterstützungsmittel, die die persönliche Unabhängigkeit des Patienten fördern, z. B. Schuhlöffel mit langem Stiel oder angepasste Schneidebretter für die Lebensmittelzubereitung. Ebenso ist dieser Fachkraft die Aufgabe zuzuordnen, das Wohnumfeld anzupassen und die Zugänglichkeit der vom Patienten frequentierten Orte zu gewährleisten [33]. Schließlich dürfen Dokumente im Zusammenhang mit der beruflichen Praxis nicht vernachlässigt werden, wie z. B. administrative Unterlagen zum Abhängigkeitsgrad bei der Durchführung der ADL oder die Notwendigkeit verschiedener Hilfsmittel.
Die Besonderheiten von Patienten mit Hirnschaden erfordern einen spezifischen Ansatz in Bezug auf Bewertung und Behandlung, wobei die Bedeutung ihrer kognitiven Defizite als langfristige Prädiktoren für eine ungünstige funktionelle Prognose im Hinblick auf den Bedarf an Hilfe durch Dritte bei der Durchführung der ADL hervorgehoben wird.
Generalisierung
Das Ziel der Ergotherapie bei Patienten mit EHS sollte darin bestehen, die Generalisierung neuer Fähigkeiten in vielfältigen realen Kontexten zu fokussieren.
Es wird empfohlen, ADL sowohl als Ziel als auch als therapeutisches Mittel zu verwenden, anstatt isolierte Übungen repetitiv durchzuführen, wobei die Besonderheiten des Patienten nach der Verletzung zu berücksichtigen sind.
In der letzten Dekade hat die Ergotherapie als Disziplin sowohl in der stationären Versorgung als auch im gemeindenahen Bereich eine zunehmend bedeutendere Rolle eingenommen und ihre Wirksamkeit, Kosteneffizienz und Notwendigkeit zur Verbesserung der funktionellen Ergebnisse bei Patienten mit erworbenem Hirnschaden unter Beweis gestellt.
Literatur
- Tickle-Degnen L., Rosenthal R. The behavioural and cognitive response of brain damaged patients to therapist instructional style. Occupl Ther J Res 1990; 10: 345-59.
- García Peña M, Sánchez Cabeza A, Miján de Castro E. Funktionelle Bewertung und Ergotherapie bei erworbenem Hirnschaden. Rehabilitación (Madr) 2002; 36 (3): 167-75.
- Jackson JD. After rehabilitation: meeting the long-term needs of persons with traumatic brain injury. Am J Occup Ther 1994; 48: 251-255.
- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría de Estado de Servicios Sociales. Familias y Discapacidad. Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) (2001). Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Madrid: IMSERSO;2001.
- Toglia JP. Approaches to cognitive assessment of the brain injured adult: Traditional methods and dynamic investigation. Occup Ther Prac 1989; 1: 36-55.
- Neistadt ME. Occupational therapy for adults with perceptual deficits. Am J Occup Ther 1988; 42: 434-40.
- Mathiowetz V, Bass Haugen J. Motor behaviour research: implications for therapeutic approaches to central nervous system dysfunction. Am J Occup Ther 1994; 48: 733-39.
- Mulder T. A process-oriented model of human motor behaviour: toward a theory based rehabilitation approach. Phys Ther 1991; 71: 157-63.
- Nashner LM, McCollum G. The organization of human postural movements: a formal basis and experimental synthesis. Behav Brain Sci 1985; 8: 135-39.
- Hinojosa J, Sabari J, Pedretti L. Position paper: purposeful activity. Am J Occup Ther 1993; 47: 1081-85.
Weitere Literatur
- Trombly CA. Occupation: purposefulness and meaningfulness as therapeutic mechanisms. Am J Occup Ther 1995; 49: 960-63.
- Sabari JS. Motor learning concepts applied to activity-based intervention with adults with hemiplegia. Am J Occupl Ther 1991; 45: 523-26.
- Shumway-Cook A, Woollacott M. Motor control: theory and practical applications. Baltimore: Williams and Wilkins; 1995.
- Schmidt RA. Motor learning principles for physical therapy. In: Lister MJ, editor. Contemporary management of motor control problems: proceedings of the II Step conference. Alexandria: Foundation for Physical Therapy; 1991. p.1-20.
- Winstein CJ. Designing practice for motor learning: clinical implications. In: Lister MJ, editor. Contemporary management of motor control problems: proceedings of the II Step conference. Alexandria: Foundation for Physical Therapy; 1991. p.65-76.
- Jarus T. Motor learning and occupational therapy: the organization of practice. Am J Occup Ther 1994;48: 810-14.
- Higgins JR, Spaeth RK. Relationship between consistency of movement and environmental condition. Quest 1972; 17: 61-67.
- Bakshi R, Bhambhani Y, Madill H. The effects of task preference on performance during purposeful and nonpurposeful activities. Am J Occup Ther 1991; 45: 912-16.
- Zimmerer-Branum S, Nelson DL. Occupationally embedded exercise versus rote exercise: a choice between occupational forms by elderly nursing home residents. Am J Occup Ther 1995; 49: 397-41.
- Trombly C.. Clinical practice guidelines for post-stroke rehabilitation and occupational therapy practice. Am J Occup Ther 1995; 49:711-715.
Weitere Referenzen
- Carr JH, Shepherd RB. A motor relearning program for stroke Ed 2º. Rockville, Md: Aspen; 1987.
- Carr JH, Shepherd RB. Early care of the stroke patient: a practice approach. London: Heinemann; 1983.
- Davies PM. Steps to follow. A guide to the treatment of adult hemiplegia. New York: Springer-Verlag; 1985.
- McCoy AO, Van Sant AF. Movement patterns of adolescent rising from a bed. Phys Ther 1993; 73:182-86.
- Morton GG, Barnett DW, Hale LS. A comparison of performance measures of an added-purpose task versus a single-purpose task for upper extremities. Am J Occup Ther 1992; 46: 128-32.
- Toglia JT. Generalization of treatment: a multicontext approach to cognitive perceptual impairment in adults with brain injury. Am J Occup Ther 1991; 45: 505-09.
- Toglia JP. Visual perception of objects: an approach to assessment and intervention. Am J Occup Ther 1989; 43: 587-94.
- Abreu BC. The effect of environmental regulations on postural control after stroke. Am J Occup Ther 1995; 49: 517-25.
- Abreu BC. The quadraphonic approach: management of cognitive-perceptual and postural control dysfunction. Occup Ther Prac. 1992; 3: 12-29.
- Magill RA. Motor learning concepts and applications. 4th ed. Madison: Brown and Benchmark; 1993.
- Neistadt ME. The neurobiology of learning: implications for treatment of adults with brain injury. Am J Occup Ther 1994; 48: 421-30.
- Sánchez-Cabeza A, García-Peña M. Reflexionen zum Behandlungsprozess kognitiver und perzeptiver Dysfunktionen. Revista informativa de la Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales 2002; 28: 2-13.
- Radomski MV. Occupational therapy practice guidelines for adults with traumatic brain injury. USA: American Occupational Therapy Association; 1997.
Wenn Ihnen dieser Artikel des Ergotherapeuten Ángel Sánchez über Ergotherapie bei Patienten mit erworbenem Hirnschaden gefallen hat, könnten Sie auch an den folgenden Artikeln interessiert sein:
Dieser Artikel wurde übersetzt; Link zum Originalartikel auf Spanisch:
Terapia ocupacional en pacientes con daño cerebral sobrevenido

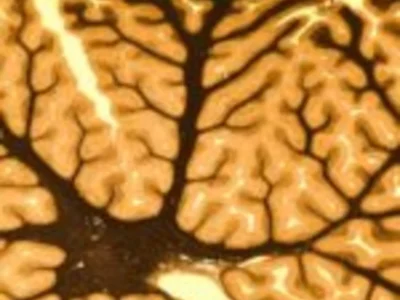
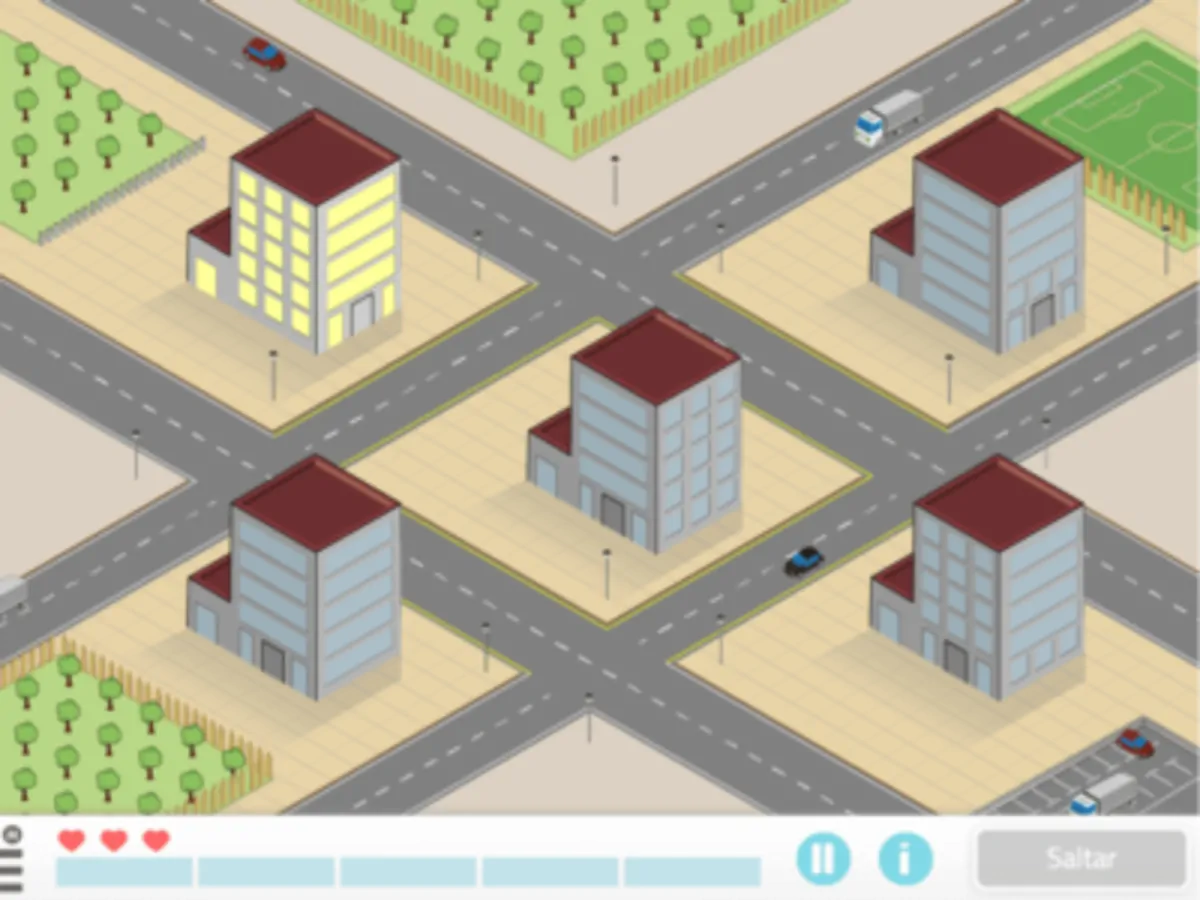




Schreiben Sie einen Kommentar