Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnete Stress als eine der Krankheiten des 21. Jahrhunderts. Seit den Pionierstudien wurde Stress definiert als Allgemeines Anpassungssyndrom (AAS) oder als Abwehrreaktion des Körpers oder der Psyche auf Verletzungen oder anhaltenden Stress (Selye, 1956).
Im Anschluss haben zahlreiche Autoren versucht, den Stresszustand zu definieren. Zweifellos stammt die umfassendste Konzeptualisierung von McEwen (2000), der ihn definierte als: „ein mentaler Zustand, der bei einer realen oder vermeintlichen Bedrohung der physiologischen oder psychologischen Integrität eines Individuums entsteht und in einer physiologischen und/oder Verhaltensantwort resultiert“ (S. 173).
Es gibt verschiedene Arten von Stress, abhängig von mehreren Faktoren wie:
- Dauer.
- Die Stimuli, die die erste Reaktion auslösen.
- Die psychologischen oder physiologischen Folgen, die zusammen mit dem Stressereignis ausgelöst werden.
- Der Kontext, der die Stressreaktion beeinflusst.
Unter Berücksichtigung von Punkt 2 und 4 sowie der Tatsache, dass der Arbeitskontext eine der größten Stressquellen darstellt, widmet sich dieser Beitrag dem Arbeitsstress.
Arbeitsstress
Arbeitsstress ist eine Form des Stresses im Arbeitsbereich, die punktuell oder chronisch sein kann, wobei die meisten Fälle dem zweiten Typ entsprechen (Cavanaugh, Boswell, Roehling und Boudreau, 2000).
Es ist wichtig zu wissen, dass Arbeitsstress positiv oder negativ sein kann (Kung und Chan, 2014).
Positiver Arbeitsstress
Positiver Stress (Eustress) bezieht sich auf eine adaptive Stressreaktion, deren Folgen die ganzheitliche Gesundheit der Person nicht beeinträchtigen und deren Dauer sich an die Dauer des Stressreizes anpasst. Zum Beispiel ist die Stressreaktion am ersten Arbeitstag adaptiv (positiver Stress), da sie erfordert, dass Sie wachsam sind, um auf neue Reize (Aufgaben, Vorgesetzte, Kollegen, Unternehmensabläufe usw.) zu reagieren.
Negativer Arbeitsstress
Wann hört diese Reaktion auf, adaptiv zu sein und kann somit in negativen Stress umschlagen? Wenn dieser Stress länger als einen Monat anhält, die Reaktion mit der Zeit intensiver wird und beginnt, die Gesundheit des Arbeitnehmers zu beeinträchtigen (es treten Schlaflosigkeit, Tachykardie, Angstzustände, Depression und andere Probleme auf), spricht man von negativem Arbeitsstress und es sollten entsprechende Maßnahmen ergriffen werden (wir empfehlen die Lektüre der Metaanalyse von Hargrove, Quick, Nelson und Quick, 2011).
Ursachen von Arbeitsstress
Es gibt zahlreiche Studien, die sich darauf konzentrieren, die Ursachen und unmittelbaren Folgen dieser Stressart, des Arbeitsstresses, zu ermitteln. Im Folgenden nennen wir einige der bemerkenswertesten Schlussfolgerungen:
- Es wurde festgestellt, dass das Mobbing am Arbeitsplatz sofort eine intensive und langanhaltende Stressreaktion auslöst (Balducci, Fraccaroli und Schaufeli, 2011; Hoobler, Rospenda, Lemmon und Rosa, 2010; Neall und Tuckey, 2014). Dies ist besonders wichtig vor dem Hintergrund, dass 8 von 10 spanischen Arbeitnehmern sich unzufrieden mit ihrer Arbeit fühlen (CepymeNews, 2018).
- Es hat sich gezeigt, dass Arbeitsstress in den meisten Fällen auf eine Aufgabenüberlastung am Arbeitsplatz und die Unklarheit der Aufgabenbereiche zurückzuführen ist (Babatunde, 2013; Ganster und Rosen, 2013).
- Außerdem wurde vorgeschlagen, dass ein niedriges Gehalt mit dem Auftreten von Arbeitsstress in Zusammenhang steht (Raver und Nishii, 2010).
- Andere haben festgestellt, dass eine fehlende intrinsische Motivation zur Arbeit sowie das Ausbleiben von Anreizen direkte Ursachen für Arbeitsstress sind (Conley und You, 2014; Karimi und Alipour, 2011).
Faktoren, die Arbeitsstress beeinflussen
Es wurde zudem festgestellt, dass bestimmte Faktoren die Entstehung und Charakteristika von Arbeitsstress beeinflussen. Diese Faktoren sind auslösend oder bedingend für Arbeitsstress. Obwohl es keine allgemein anerkannte Liste dieser Faktoren gibt, haben einige Voruntersuchungen angenommen, dass sie sein könnten: das Alter der vom Arbeitsstress betroffenen Person, die Art der Arbeit, vorausgegangene psychische Störungen, die Dauer der vorherigen Arbeitslosigkeit,
einige Persönlichkeitsmerkmale wie Neurotizismus und Psychotizismus, das Geschlecht der Betroffenen und familiäre Verpflichtungen, unter anderem (Colligan und Higgins, 2006; Ganster und Rosen, 2013).
Folgen von Arbeitsstress
Abschließend müssen auch die mit Arbeitsstress verbundenen Folgen hervorgehoben werden.
Kognitive Folgen
Einige Studien haben sich stärker auf die kognitiven Folgen konzentriert, die Gedächtnisprobleme (Lapsus und selektives Vergessen arbeitsbezogener Informationen), Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit auf berufliche Themen zu richten, Konzentrationsprobleme und eine Abnahme der Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig auszuführen (Fehler im Arbeitsgedächtnis), umfassen (Wiegel, Sattler, Göritz und Diewald, 2014; Rickenbach et al., 2014).
Physische Folgen
Andere Arbeiten haben sich mehr für die physischen Folgen von Arbeitsstress interessiert und vorgeschlagen, dass Betroffene häufig über Schlaflosigkeit, abnorme kardiovaskuläre Parameter, das Auftreten von Bluthochdruck und Diabetes, Schilddrüsenprobleme, und in einem großen Teil der Fälle Symptome dermatologischer Erkrankungen sowie Kopfschmerzen und Spannungskopfschmerzen klagen (Ganster und Rosen, 2013; Heraclides, Chandola, Witte und Brunner, 2012; Kivimäki und Kawachi, 2015; McCraty, Atkinson und Tomasino, 2003).
Emotionale Folgen
Ebenso hat eine dritte Gruppe von Untersuchungen die emotionalen Folgen von Arbeitsstress in den Fokus gerückt. Dazu gehören emotionale Labilität, Panikattacken, Angstzustände und depressive Symptome (Tennant, 2001; Brosschot, Verkuil und Thayer, 2016).
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Arbeitsstress nicht immer negativ ist, sondern von der Intensität, der Dauer und der adaptiven Funktion der Stressreaktion selbst abhängt. Zudem gibt es zahlreiche Untersuchungen zu diesem Thema, sodass wir das aktuelle Wissen über Ursachen, Symptomatik und Folgen proaktiv nutzen können, um frühzeitig einzugreifen und zu verhindern, dass Arbeitsstress unsere körperliche und psychische Gesundheit beeinträchtigt.
Gez.: AMUNE (Murcianische Gesellschaft für Neurowissenschaften)

Melden Sie sich
für unseren
Newsletter an
Literaturverzeichnis
- Babatunde, A. (2013). Occupational Stress: A Review on Conceptualisations, Causes and Cure. Economic Insights-Trends & Challenges, 65(3).
- Balducci, C., Fraccaroli, F. und Schaufeli, W. B. (2011). Workplace bullying and its relation with work characteristics, personality, and post-traumatic stress symptoms: An integrated model. Anxiety, Stress & Coping, 24(5), 499-513.
- Brosschot, J. F., Verkuil, B. und Thayer, J. F. (2016). The default response to uncertainty and the importance of perceived safety in anxiety and stress: An evolution-theoretical perspective. Journal of anxiety disorders, 41, 22-34.
- Cavanaugh, M. A., Boswell, W. R., Roehling, M. V. und Boudreau, J. W. (2000). An empirical examination of self-reported work stress among US managers. Journal of applied psychology, 85(1), 65.
- CepymeNews. (2018). Spanien ist das europäische Land mit dem höchsten Arbeitsstress. Abgerufen am 25. September 2018 von: https://cepymenews.es/espana-es-el-pais-europeo-con-mas-estres-laboral/
- Colligan, T. W. und Higgins, E. M. (2006). Workplace stress: Etiology and consequences. Journal of workplace behavioral health, 21(2), 89-97.
- Conley, S. und You, S. (2014). Role stress revisited: Job structuring antecedents, work outcomes, and moderating effects of locus of control. Educational Management Administration & Leadership, 42(2), 184-206.
Weitere Referenzen:
- Ganster, D. C. und Rosen, C. C. (2013). Work stress and employee health: A multidisciplinary review. Journal of Management, 39(5), 1085-1122.
- Hargrove, M. B., Quick, J. C., Nelson, D. L. und Quick, J. D. (2011). The theory of preventive stress management: a 33‐year review and evaluation. Stress and Health, 27(3), 182-193.
- Heraclides, A. M., Chandola, T., Witte, D. R. und Brunner, E. J. (2012). Work stress, obesity and the risk of type 2 diabetes: gender‐specific bidirectional effect in the whitehall II study. Obesity, 20(2), 428-433.
- Hoobler, J. M., Rospenda, K. M., Lemmon, G. und Rosa, J. A. (2010). A within-subject longitudinal study of the effects of positive job experiences and generalized workplace harassment on well-being. Journal of Occupational Health Psychology, 15(4), 434.
- Karimi, R. und Alipour, F. (2011). Reduce job stress in organizations: Role of locus of control. International Journal of Business and Social Science, 2(18), 232-236.
- Kivimäki, M. und Kawachi, I. (2015). Work stress as a risk factor for cardiovascular disease. Current cardiology reports, 17(9), 74.
- Kung, C. S. und Chan, C. K. (2014). Differential roles of positive and negative perfectionism in predicting occupational eustress and distress. Personality and Individual Differences, 58, 76-81.
- McCraty, R., Atkinson, M. und Tomasino, D. (2003). Impact of a workplace stress reduction program on blood pressure and emotional health in hypertensive employees. The Journal of Alternative & Complementary Medicine, 9(3), 355-369.
Literatur
- McEwen, B. S. (2000). The neurobiology of stress: from serendipity to clinical relevance1. Brain research, 886(1-2), 172-189.
- Neall, A. M. und Tuckey, M. R. (2014). A methodological review of research on the antecedents and consequences of workplace harassment. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 87(2), 225-257.
- Raver, J. L. und Nishii, L. H. (2010). Once, twice, or three times as harmful? Ethnic harassment, gender harassment, and generalized workplace harassment. Journal of Applied Psychology, 95(2), 236.
- Rickenbach, E. H., Almeida, D. M., Seeman, T. E. und Lachman, M. E. (2014). Daily stress magnifies the association between cognitive decline and everyday memory problems: An integration of longitudinal and diary methods. Psychology and aging, 29(4), 852.
- Selye, H. (1956). The stress of life. New York: McGraw-Hill Book Company
- Tennant, C. (2001). Work-related stress and depressive disorders. Journal of psychosomatic research, 51(5), 697-704.
- Wiegel, C., Sattler, S., Göritz, A. S. und Diewald, M. (2016). Work-related stress and cognitive enhancement among university teachers. Anxiety, Stress, & Coping, 29(1), 100-117.
Wenn Ihnen dieser Artikel über Arbeitsstress gefallen hat, könnten Sie auch an diesen anderen Blogbeiträgen interessiert sein:
Dieser Artikel wurde übersetzt; Link zum Originalartikel auf Spanisch:
El estrés laboral: definición, causas y consecuencias para la salud

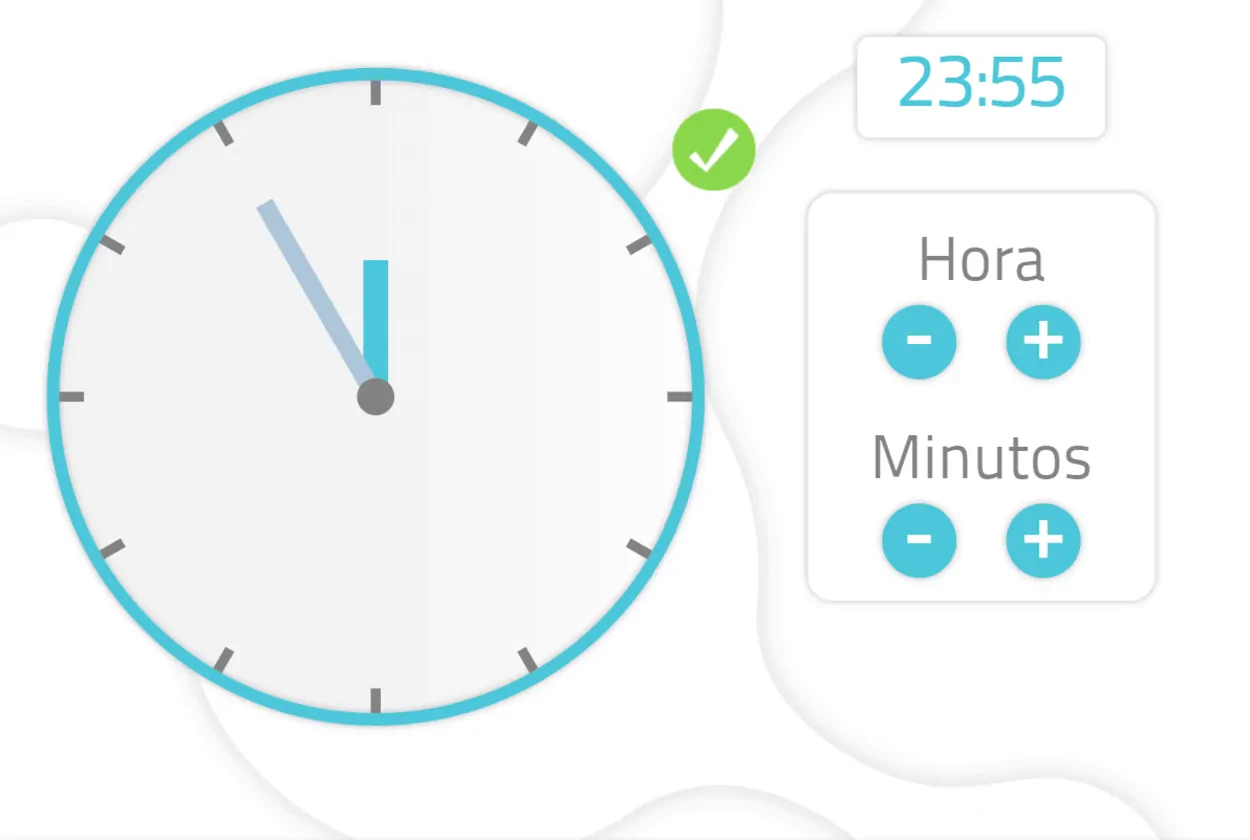 5 Übungen zur Verbesserung des Gedächtnisses
5 Übungen zur Verbesserung des Gedächtnisses
Schreiben Sie einen Kommentar