Weißt du, wie Phobien entstehen? Könntest du erkennen, ob du darunter leidest? Oder wie man sie beseitigt? Die Neuropsychologin Cintia Martos erklärt uns die Hauptmerkmale von Phobien und die Beziehung zwischen Gehirn und Phobien.
Was sind Phobien?
Eine Phobie wird definiert als eine intensive Angst, die sofort bei einem bestimmten Objekt oder einer konkreten Situation auftritt. Die häufigsten Phobien betreffen meist bestimmte Tiere oder Insekten. Auch gehören Angst vor dem Fliegen, vor Höhen, vor Injektionen oder vor Blut zu den gängigen Phobien. Allerdings können phobische Situationen und Objekte unendlich vielfältig sein.
Obwohl Angst eigentlich dazu dienen sollte, uns zu schützen, wird sie bei Phobien zu etwas Maladaptivem, das unsere alltäglichen Aktivitäten beeinträchtigen kann. Wie Ängste werden auch Phobien erlernt und gehen mit plastischen Veränderungen im Gehirn einher, die sehr schnell erfolgen. Diese Veränderungen sind zudem sehr widerstandsfähig gegenüber Auslöschung, da der Organismus interpretiert, dass seine Überlebenschancen in Gefahr wären, wenn die Angst nachließe.
Merkmale: Anzeichen dafür, dass du an einer Phobie leidest
Nach den diagnostischen Kriterien des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. Ausgabe (DSM-5), weisen Phobien folgende Merkmale auf:
- Das Objekt oder die Situation, die die Angst auslöst, wird meist aktiv vermieden. Die Person wehrt sich dagegen, in der gefürchteten Situation zu bleiben, was zu einer Beeinträchtigung der Lebensqualität führen kann, besonders wenn der phobische Reiz im Alltag auftreten kann.
- Die Angst oder die Angstreaktion ist anhaltend und dauert länger als sechs Monate.
- Bei Reflexion ist die erlebte Angst unverhältnismäßig im Hinblick auf die tatsächliche Gefahr, die von dieser Situation oder diesem Objekt ausgeht.
- Die Angst, die Angstreaktion oder das Vermeidungsverhalten führt zu erheblichem Leidensdruck oder beeinträchtigt die Funktionsbereiche der Person (wie den sozialen oder beruflichen Bereich).
Wie entstehen Phobien?
Angst und Angstzustände haben einen biologischen Ursprung, das heißt, sie sind evolutionäre Reaktionen, deren Zweck es ist, eine Gefahr zu erkennen oder vorauszusehen. Die Angst geht einher mit autonomen und endokrinen Veränderungen, die den Organismus darauf vorbereiten, auf die Gefahr zu reagieren (Kampf, Flucht oder Erstarrung) mit dem Ziel, die Überlebenschancen zu erhöhen.
Diese Angst kann jedoch maladaptiv sein, wie es im Fall der Phobien vorkommt. Da sie neben dem Umstand, dass sie nicht wesentlich zum Überleben beiträgt, auch Schwierigkeiten im Alltag erzeugen kann.
Organismen besitzen angeborene Ängste, das heißt, sie können von Geburt an entstehen, ohne dass sie durch Erfahrung erlernt wurden. Zum Beispiel schmerzhafte oder sehr intensive Reize wie laute Geräusche. Wenn Lebewesen jedoch ihre Umwelt kennenlernen, nehmen sie allmählich aversive und gefährliche Situationen wahr. Nach und nach lernen sie, welche das sind und wo sie typischerweise auftreten, um sie effizient zu vermeiden oder sich ihnen zu stellen. Diese erlernte Angst bleibt zwar adaptiv, kann jedoch maladaptiv werden, wie es bei Phobien und Angststörungen der Fall ist.
Pawlowsche Konditionierung
Wenn ein neutraler Reiz, wie zum Beispiel ein Geräusch, zusammen mit einem aversiven Reiz auftritt, kann der ursprünglich bedeutungslose neutrale Reiz allein schon Angst im Subjekt auslösen. Ein Beispiel ist, wenn ein Geräusch mit einem Elektroschock verbunden wird. Dies geschieht, weil die Verbindung Geräusch-Elektroschock schnell im Gedächtnis gespeichert wird, sodass die Angstreaktion bereits beim Hören des Geräusches auftritt. Das Erlernen von Angst wird meist durch diese Form der Konditionierung erklärt.
Die Angstkonditionierung ist ein sehr schneller und kraftvoller Prozess. Ein einziger Durchgang, in dem diese beiden Reize zusammen präsentiert werden, kann bereits die Angsterlernung im Gedächtnis festigen.
Theorie der biologischen Preparedness
Nach der Theorie der biologischen Preparedness von Martin Seligman entstehen Phobien durch eine Reihe von biologischen Assoziationen, die der Organismus evolutionär schnell und nachhaltig zu erlernen bereit ist. So ist die Konditionierung auf relevante Angstreize wie Schlangen, Spinnen, Gesichtsausdrücke von Furcht oder Wut oder Gesichter anderer sozialer Gruppen resistenter gegen Auslöschung und kann sich ohne bewusstes Zutun des Individuums festigen.
Einmal erlernt, kann die konditionierte Angst ein Leben lang bestehen bleiben. Die Angstreaktionen können jedoch durch Erfahrungen, die zeigen, dass dieser Reiz keine Gefahr mehr darstellt, abgeschwächt oder gelöscht werden.
Beziehung zwischen Gehirn und Phobien
Der Erwerbsprozess von Phobien hat zerebrale Grundlagen. Unser Gehirn ist plastisch, das heißt, es verändert sich entsprechend unseren Gewohnheiten und Lernerfahrungen. Wenn die Angstkonditionierung stattfindet, geht dies mit molekularen und strukturellen Veränderungen in bestimmten Neuronen einher.
Hirnstrukturen in der Beziehung zwischen Gehirn und Phobien
Amygdala
Die hauptsächliche in Phobien involvierte Hirnstruktur ist die Amygdala. Diese Struktur wird allgemein mit Emotionen assoziiert, insbesondere mit Angst. In ihr werden die Verbindungen zwischen dem gefürchteten Reiz und dem ihn umgebenden Kontext hergestellt. Außerdem löst sie Aktivierungsreaktionen im Organismus aus, damit auf die Gefahr schnell reagiert werden kann.
Sie ist ein mandelförmiger, kleiner Hirnbereich im Inneren unseres Gehirns und gehört zum limbischen System (emotionales System). Die Amygdala ist eine komplexe Struktur, die mehrere Gruppen von Neuronen enthält, von denen jede spezifische Funktionen hat und untereinander verbunden ist.
Laterale Amygdala
Sie empfängt alle sensorischen Informationen (visuell, auditiv, taktil…) und verknüpft sie mit dem gefürchteten Reiz. Es wurde gezeigt, dass diese Informationen auf „zwei Wegen“ bzw. über zwei unterschiedliche sensorische Eingänge reisen können. Zum einen der thalamische Weg. Dies ist der kürzeste Weg, der Informationen schnell und ungenau übermittelt. Zum anderen der kortikale Weg, bei dem eine komplexere, elaborierte und bewusste Repräsentation des externen Reizes entsteht.
In diesem Bereich finden die wesentlichen synaptischen Veränderungen beim Erlernen der Phobie statt. Die neuronalen Verbindungen werden stärker, während die Angstkonditionierung etabliert wird.
Zentralkern der Amygdala
Er ist dafür zuständig, die verarbeiteten Informationen an Bereiche des Hirnstamms weiterzuleiten, die die Ausprägung der Angstantworten wie Erstarrung steuern. Dadurch werden adrenerge, serotoninerge, dopaminerge und cholinerge Systeme aktiviert, die endokrine und autonome Veränderungen hervorrufen, die typisch für Angst sind.
Basalkern
Er empfängt Informationen vom Hippocampus, der entorhinalen Rinde und polymodalen Assoziationsbereichen. Außerdem speichert dieser Bereich der Amygdala Informationen über den Umweltkontext, in dem die Bedrohung auftrat. Aus diesem Grund empfinden wir Angst an Orten, an denen in der Vergangenheit ein phobischer Reiz aufgetreten ist, auch wenn dieser in diesem Moment nicht präsent ist.
Interkalierte Zellen
Eine Gruppe von GABAergen, also inhibitorischen Neuronen. Sie können Angstantworten hemmen, indem sie die Informationsweiterleitung von der lateralen und basalen Amygdala zum Zentralkern blockieren. Zum Beispiel bei einem Fehlalarm.
Interessante Studien zum Gehirn und Phobien
Tierversuche haben gezeigt, dass durch Stimulation des Zentralkerns der Amygdala verschiedene Komponenten der Angstreaktion ausgelöst werden können. Wird dieser Bereich hingegen geschädigt, nimmt die Angst gegenüber konditionierten Reizen ab. Zudem kann das Subjekt keine neuen Ängste mehr erlernen.
Andererseits, wenn die Schädigung im Hippocampus auftritt – dem Bereich, der der Amygdala Informationen über den Ort liefert, an dem der gefürchtete Reiz erschien – würde nur die Kontextangst verschwinden, nicht jedoch die Angst vor dem Reiz selbst.
Hinsichtlich der Gehirnaktivität bei Phobien fanden Schienle et al. (2005) Unterschiede zwischen Personen mit Spinnenphobie und solchen ohne diese Phobie, während sie Bilder von Spinnen und neutralen Bildern betrachteten. Phobiker zeigten eine stärkere Aktivierung in der Amygdala, der visuellen Assoziationsrinde, dem rechten Hippocampus und dem rechten dorsolateralen präfrontalen Kortex. Dieser letztere Bereich scheint mit der Verarbeitung negativer Emotionen assoziiert zu sein. Ebenfalls wurde eine Aktivierung im supplementär-motorischen Areal beobachtet (das mit der Vorbereitung und Motivation von Bewegungen verknüpft ist). Zudem ergab sich, dass je unangenehmer ein Bild empfunden wurde, desto stärker die Aktivität in der Amygdala war.
Eine 2012 veröffentlichte Metaanalyse hob neben der Amygdala auch eine Hyperaktivität in der Insula von phobischen Probanden hervor. Beide Strukturen stehen mit negativen emotionalen Reaktionen in Verbindung.
Eine Phobie beseitigen unter Berücksichtigung der Beziehung zwischen Gehirn und Phobien
Eine Phobie kann durch wiederholte Exposition gegenüber dem gefürchteten Reiz in einem neutralen oder sicheren Kontext ausgelöscht werden. Nach und nach lernt man, dass das phobische Objekt oder Ereignis keine Gefahr mehr bedeutet. Dies ist die Grundlage effektiver Expositionstherapien.
All dies hat eine zerebrale Grundlage, denn es wurde gezeigt, dass die Auslöschung von Angst mit einer Interaktion zwischen Amygdala, Hippocampus und medialem präfrontalem Kortex zusammenhängt.

Melden Sie sich
für unseren
Newsletter an
Quellen
- American Psychiatric Association. (2013). Leitfaden zu den diagnostischen Kriterien des DSM-5.
- Dbiec, J., & LeDoux, J. (2009). Die Amygdala und die neuronalen Pfade der Angst. In Post-Traumatic Stress Disorder (S. 23–38). Humana Press.
- Etkin, A., & Wager, T. D. (2007). Funktionelle Neurobildgebung bei Angst: Eine Meta-Analyse der emotionalen Verarbeitung bei PTBS, sozialer Angststörung und spezifischer Phobie. The American Journal of Psychiatry, 164(10), 1476–1488. http://doi.org/10.1176/appi.ajp.2007.07030504
- LaBar, K. S., & Cabeza, R. (2006). Kognitive Neurowissenschaften des emotionalen Gedächtnisses. Nature Reviews Neuroscience, 7(1), 54.
- Sánchez Navarro, J. P., & Román, F. (2004). Amygdala, präfrontaler Kortex und hemisphärische Spezialisierung in der emotionalen Erfahrung und im Ausdruck. Anales de Psicología, 20(2).
- Schienle, A., Schäfer, A., Walter, B., Stark, R., & Vaitl, D. (2005). Gehirnaktivierung bei Spinnenphobikern gegenüber störungsspezifischen, meist ekel- und angstinduzierenden Bildern. Neuroscience Letters, 388(1), 1–6.
Wenn dir dieser Beitrag über Gehirn und Phobien: Wie sie zusammenhängen gefallen hat, könnte dich auch interessieren:
Dieser Artikel wurde übersetzt; Link zum Originalartikel auf Spanisch:
Cerebro y fobias: ¿Cómo se relacionan?

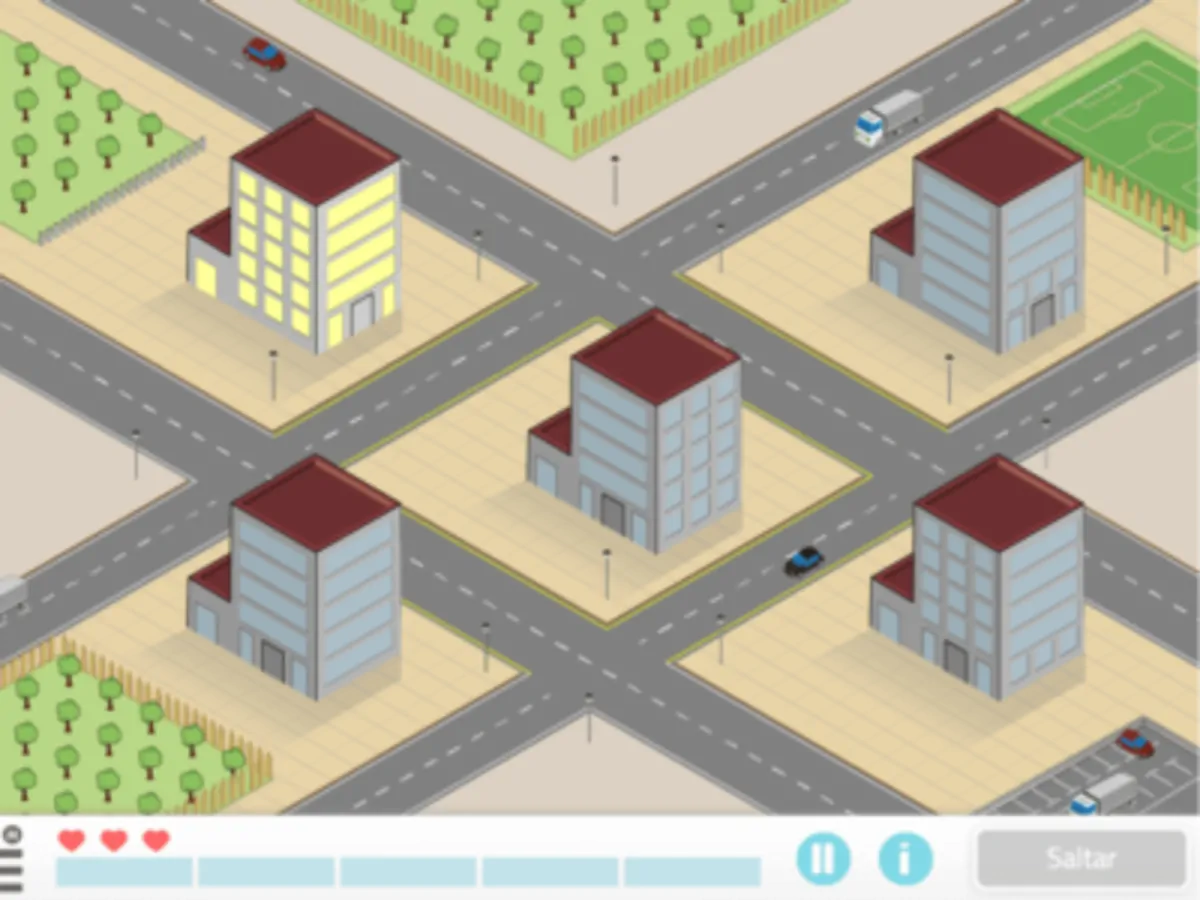
Schreiben Sie einen Kommentar