Die Neuropsychologin Sofía Fonseca Moreno analysiert , wie die Herzfrequenzvariabilität (VFC) den kognitiven Abbau im Alter beeinflusst .
Einführung
Die Lebenserwartung ist gestiegen, weshalb die Gruppe der über 60-Jährigen weltweit (Organización Mundial de la Salud, 2015) — einschließlich Mexiko — gewachsen ist. Mit zunehmendem Alter ist es zu erwarten, dass verschiedene kognitive Funktionen zu beeinträchtigen beginnen. Dieser Abbau kann jedoch so schwerwiegend sein, dass er die Lebensqualität der betroffenen Personen erheblich beeinträchtigt (Aveleyra & Ostrosky, 2007; Forte et al., 2019; Mejía-Arango et al., 2007).
Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, Interventionen zu kennen, die ein gesundes kognitives Altern fördern, wie etwa das Biofeedback der Herzfrequenzvariabilität (VFC), eine evidenzbasierte Intervention (Moss, 2004).
Kognitive Funktionen und Altern
Was sind kognitive Funktionen?
Die kognitiven Funktionen werden als jene geistigen Fähigkeiten definiert, die es uns Menschen erlauben, Informationen aus der Umwelt korrekt zu interpretieren und zu verarbeiten. Ein angemessenes kognitives Funktionieren ist essenziell, da es uns ermöglicht, alle unsere Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) optimal auszuführen, wie Lesen, Führen eines Fahrzeugs, Schreiben, Sprechen, Schlussfolgern, Planen usw. Zu diesen kognitiven Funktionen gehören Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Sprache und exekutive Funktionen (Aveleyra & Ostrosky, 2007; Forte et al., 2019).
Kognitive Veränderungen im Zusammenhang mit dem Altern
Während des Alterns treten verschiedene Veränderungen auf, wie der Abbau bestimmter Hirnstrukturen und der Verlust von Nervengewebe. Dies verändert sowohl die Gehirnfunktion als auch die kognitive Leistungsfähigkeit.
Zu den häufigsten Veränderungen gehören Schwierigkeiten in den Wahrnehmungsfähigkeiten, im Gedächtnis und Lernen, Störungen visuospatiales und konstruktiver Fähigkeiten, eine geringere Schwierigkeit, neue Informationen aufzunehmen, sowie eine Verlangsamung motorischer Reaktionen. Es können auch Veränderungen der Sprache und verbaler Prozesse auftreten, obwohl diese Funktionen in manchen Fällen eine gewisse Resistenz gegenüber dem Abbau zeigen und sich im höheren Alter sogar verbessern können (Ardilla, 2012).
Die zuvor genannten Veränderungen gelten als normal. Wenn sie jedoch so weit fortschreiten, dass sie die Lebensqualität und die Alltagsfunktion einer Person beeinträchtigen (Forte et al., 2019), können sie mit einem kognitiven Abbau in Verbindung stehen, der nicht mehr dem normalen Altern entspricht, wie etwa der leichte kognitive Abbau (DCL) (Aveleyra & Ostrosky, 2007).
Was ist der leichte kognitive Abbau (DCL)?
Der leichte kognitive Abbau ist ein Zustand, der durch das Vorhandensein einer erheblichen Beeinträchtigung in einer oder mehreren kognitiven Funktionen gekennzeichnet ist, die jedoch die funktionale Autonomie der Person nicht wesentlich beeinträchtigt (American Psychiatric Association, 1994).
Nach dem National Institute on Aging und der Alzheimer’s Association umfassen die diagnostischen Kriterien die Besorgnis des Patienten oder eines Informanten über Veränderungen der Kognition im Vergleich zum vorherigen Zustand, das Vorhandensein von Beeinträchtigungen kognitiver Funktionen, die Aufrechterhaltung der funktionalen Unabhängigkeit, wenn auch mit größerer Langsamkeit oder Fehlern, und das Fehlen klinischer Zeichen, die auf eine Demenz hinweisen (Albert et al., 2011; McKhann et al., 2011). Obwohl es sich nicht um eine Form der Demenz handelt, stellt DCL dennoch einen wichtigen Warnhinweis dar, da die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein leichter kognitiver Abbau in eine Demenz entwickelt, auf etwa 10 % bis 15 % geschätzt wird (Albert et al., 2011).
Die Variabilität der Herzfrequenz und das Altern
Die Veränderungen der kognitiven Funktionen, die im Alter auftreten, treten nicht isoliert auf, sondern stehen in Zusammenhang mit anderen physiologischen Prozessen, die ebenfalls vom Alter betroffen sind.
Beispielsweise erfährt das Herz mit zunehmendem Alter eine Verringerung der Herzfrequenz und eine langsamere ventrikuläre Entspannung. Diese kardiovaskulären Veränderungen gehen auch mit strukturellen und funktionellen Modifikationen im Gehirn einher sowie mit einer weniger effizienten Regulation des autonomen Nervensystems, das eine Schlüsselrolle bei der physiologischen Regulation des Organismus spielt (Bozkurt et al., 2016). Vor diesem Hintergrund wurde ein Zusammenhang zwischen dem Zustand des autonomen Nervensystems und der kognitiven Leistungsfähigkeit bei älteren Erwachsenen beobachtet (Shaffer & Venner, 2013).
Mit dem Altern tragen verschiedene Faktoren zum Abbau des kardiovaskulären Systems bei, was das Risiko chronischer Erkrankungen wie Bluthochdruck erhöht. Zu diesen Risikofaktoren gehören die fortschreitende Degeneration der Arterien und die Ansammlung von Fett in den Gefäßwänden, was den inneren Durchmesser der Blutgefäße reduziert und einen adäquaten Blutfluss erschwert. Insbesondere ist Bluthochdruck in der älteren erwachsenen Bevölkerung eine sehr häufige Erkrankung und ist mit einem erhöhten Risiko für kognitiven Abbau und neurodegenerative Erkrankungen verbunden (Almeida-Santos et al., 2016).
Was ist die VFC?
Die Herzfrequenzvariabilität (VFC) ist ein Indikator für die Regulation des autonomen Nervensystems, das für die Kontrolle unwillkürlicher Funktionen wie Atmung, Verdauung und Herzfrequenz verantwortlich ist. Die VFC ist ein Phänomen des Herzzyklus, definiert als die Variation der Zeit in Millisekunden zwischen aufeinanderfolgenden Herzschlägen, und zeigt, wie gut das autonome Nervensystem funktioniert. Diese Messung gibt an, wie flexibel und anpassungsfähig der Organismus ist, um auf verschiedene Situationen zu reagieren, und eine höhere Variabilität deutet auf eine bessere Regulation hin (Acharya et al., 2006; Thayer et al., 2012).
Die allgemeine autonome Regulation des Herzens nimmt mit dem Alter ab, was zu einer fortschreitenden Verringerung der Herzfrequenzvariabilität führt und damit eine geringere Fähigkeit des Organismus widerspiegelt, sich an verschiedene physiologische Reize anzupassen und darauf zu reagieren (Almeida-Santos et al., 2016).
Die VFC kann mittels eines Elektrokardiogramms (EKG) oder mit einem Photoplethysmographen (PPG) gemessen werden, der Veränderungen des Pulsvolumens detektiert. Auf Basis dieser Messungen der Herzfrequenz ist es möglich, die Herzfrequenzvariabilität (VFC) mit verschiedenen Analysen zu untersuchen, etwa Zeitbereichs- oder Frequenzbereichsanalysen (Acharya et al., 2006).
Es wurde gezeigt, dass eine hohe VFC mit größerem psychologischem Wohlbefinden, besserer emotionaler Selbstregulation und einem geringeren Risiko für physische und psychische Erkrankungen einhergeht. Hingegen kann eine niedrige VFC auf einen weniger flexiblen Organismus hinweisen, mit geringerer Fähigkeit, sich an anspruchsvolle oder stressige Situationen anzupassen (Acharya et al., 2006; Moss, 2004).

Melden Sie sich
für unseren
Newsletter an
Zusammenhang zwischen der Hirnrinde, der VFC und den kognitiven Funktionen
Einige Hirnstrukturen sind an der Regulation der Herzfrequenz und der VFC beteiligt. Insbesondere helfen bestimmte Bereiche des Gehirns, wie die mediale und orbitofrontale Präfrontalrinde, die Herzfrequenz über den Vagusnerv zu modulieren (Williams et al., 2019).
Diese Hirnregionen stehen wiederum in Verbindung mit anderen Strukturen wie der Amygdala und einigen Kernen des Hirnstamms, die gemeinsam die Herzaktivität regulieren (Gianaros et al., 2004). Das bedeutet, dass die VFC nicht nur den Zustand des kardiovaskulären Systems widerspiegelt, sondern auch den Grad der Kontrolle, den das Gehirn über den Organismus ausübt.
Eine Studie, die den Zusammenhang zwischen der Herzfrequenzvariabilität (VFC) und der präfrontalen Hirnrinde zeigt, ist die von Gianaros (2004), die das Ziel hatte, die funktionelle Beziehung zwischen regionaler Gehirnaktivierung und autonomer Herzaktivität zu charakterisieren.
Mithilfe einer Positronen-Emissions-Tomographie (PET) schätzten sie den Blutfluss in bestimmten Regionen und erhielten einen Index der VFC als Indikator der autonomen Herzaktivität von 93 Erwachsenen im Alter von 50 bis 70 Jahren, während diese Arbeitsgedächtnisaufgaben durchführten.
Ihre Ergebnisse zeigten positive Korrelationen zwischen der VFC und den folgenden Hirnregionen: ventromediale präfrontale Rinde, Insula und amygdalo-hippocampales Komplex — Strukturen, die helfen, die autonome Herzaktivität zu regulieren (Gianaros et al., 2004).
Dies zeigt, dass wenn das Gehirn (insbesondere die Bereiche, die Emotionen und Kognition regulieren, wie die Präfrontalrinde) während kognitiver Aufgaben aktiver ist, auch eine bessere Regulation des Herzens besteht, was die Idee einer funktionellen Verbindung zwischen Gehirn und Herz stützt.
Aufgrund dieser Verbindung zwischen Gehirn und Herz kann folglich, wenn es ein Problem in diesem Regulationssystem gibt, der Blutfluss zu diesen Hirnarealen beeinträchtigt werden, was deren Fähigkeit, das Herz angemessen zu kontrollieren, vermindert. Das heißt, da Herz und Gehirn eng miteinander verbunden sind, können Veränderungen in einem dieser Systeme direkt das andere beeinflussen.
In diesem Sinne wurde eine niedrige VFC mit einer schlechteren Leistung in verschiedenen kognitiven Funktionen in Verbindung gebracht:
- Beispielsweise wurde festgestellt, dass eine geringere VFC mit schlechterer Leistung sowohl im Kurzzeit- als auch im Langzeitgedächtnis verbunden ist.
- Ebenso wurde eine reduzierte VFC mit schlechteren sprachlichen Leistungen in Verbindung gebracht, und die VFC-Werte in Ruhe haben sich als Prädiktoren der Aufmerksamkeitsleistung erwiesen.
- Auch wurde ein Zusammenhang zwischen einer geringeren VFC und schlechterer Leistung in exekutiven Funktionen sowie in visuell-räumlichen Fähigkeiten berichtet.
- Darüber hinaus zeigten Personen mit niedriger VFC eine schlechtere Leistung und einen stärkeren Abbau in der Verarbeitungsgeschwindigkeit.
Diese Ergebnisse sollten jedoch mit Vorsicht interpretiert werden, da es auch Hinweise gibt, wenn auch in geringerem Umfang, die diese Zusammenhänge nicht bestätigen, was darauf hindeutet, dass weitere Forschung erforderlich ist, um die Natur dieser Beziehung zu klären. (Forte et al., 2019; Thayer et al., 2012).
Nach wissenschaftlicher Evidenz wurde gezeigt, dass Personen mit höheren VFC-Werten eine bessere Gedächtniskontrolle und eine größere Fähigkeit haben, unerwünschte Erinnerungen zu unterdrücken.
Im Gegensatz dazu ist eine niedrige VFC mit schlechterer Leistung in verbalen Gedächtnisaufgaben verbunden, sowohl kurz- als auch langfristig. Bezüglich der Sprache wurde beobachtet, dass eine reduzierte VFC mit geringerer sprachlicher Leistungsfähigkeit einhergeht. Hinsichtlich der Aufmerksamkeit wurde gezeigt, dass die VFC in Ruhe die Aufmerksamkeitsleistung vorhersagt, wobei niedrigere VFC-Werte ein Indikator für schlechtere Leistung sind. Ebenso wurde eine geringere VFC mit schlechter Leistung in exekutiven Funktionen, visuell-räumlichen Fähigkeiten und einem stärkeren Rückgang der Verarbeitungsgeschwindigkeit in Verbindung gebracht (Forte et al., 2019).
Diese Befunde stützen die Idee, dass die VFC nicht nur ein Marker für die kardiovaskuläre Gesundheit ist, sondern auch ein Indikator für die kognitive Leistungsfähigkeit sein könnte.
Fazit
Angesichts des Dargestellten werden wir im zweiten Teil dieses Artikels näher auf das VFC-Biofeedback und dessen Funktionsweise eingehen, wobei wir Belege für seine Wirkungen auf die Verbesserung der kognitiven Funktionen und ethische Überlegungen vorstellen.
Zugang zu weiteren Informationen
Wenn Sie mehr über das VFC-Biofeedback zur Verbesserung der kognitiven Funktionen erfahren möchten, können Sie den zweiten Teil dieses Artikels hier weiterlesen.
Bibliographie
- Acharya, U. R., Joseph, K. P., Kannathal, N., Lim, C. M., & Suri, J. S. (2006). Heart rate variability: A review. Medical and Biological Engineering and Computing, 44(12), 1031–1051. https://doi.org/10.1007/s11517-006-0119-0
- Albert, M. S., DeKosky, S. T., Dickson, D., Dubois, B., Feldman, H. H., Fox, N. C., Gamst, A., Holtzman, D. M., Jagust, W. J., Petersen, R. C., Snyder, P. J., Carrillo, M. C., Thies, B., & Phelps, C. H. (2011). The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer’s disease: Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimer’s and Dementia, 7(3), 270–279. https://doi.org/10.1016/j.jalz.2011.03.008
- Almeida-Santos, M. A., Barreto-Filho, J. A., Oliveira, J. L. M., Reis, F. P., da Cunha Oliveira, C. C., & Sousa, A. C. S. (2016). Aging, heart rate variability and patterns of autonomic regulation of the heart. Archives of Gerontology and Geriatrics, 63, 1–8. https://doi.org/10.1016/J.ARCHGER.2015.11.011,
- American Psychiatric Association. (1994). DSM-IV: Diagnostic and statistical manual of mental disorders (APA (ed.); 4th ed.).
- Ardila, A. (2012). Neuropsicología del Envejecimiento Normal. Revista Neuropsicológica, Neuropsiquiátrica y Neurociencias, 12(1), 1–20.
- Aveleyra, E., & Ostrosky, F. (2007). Cambios neurofisiológicos, cognoscitivos y neuroendócrinos durante el envejecimiento. In M. Guevara, M. Hernández, N. Arteaga, & E. Olvera (Eds.), Aproximaciones al estudio de la funcionalidad cerebral y el comportamiento. Universidad de Guadalajara.
- Bozkurt, B., Aguilar, D., Deswal, A., Dunbar, S. B., Francis, G. S., Horwich, T., Jessup, M., Kosiborod, M., Pritchett, A. M., Ramasubbu, K., Rosendorff, C., & Yancy, C. (2016). Contributory Risk and Management of Comorbidities of Hypertension, Obesity, Diabetes Mellitus, Hyperlipidemia, and Metabolic Syndrome in Chronic Heart Failure: A Scientific Statement from the American Heart Association. Circulation, 134(23), e535–e578. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000450/ASSET/004E3C84-43FF-4483-B2CA-1F9E42AA3DC6/ASSETS/GRAPHIC/E535FIG05.JPEG
- Forte, G., Favieri, F., & Casagrande, M. (2019). Heart rate variability and cognitive function: A systematic review. Frontiers in Neuroscience, 13(JUL), 710. https://doi.org/10.3389/FNINS.2019.00710/BIBTEX
- Gianaros, P. J., Van Der Veen, F. M., & Jennings, J. R. (2004). Regional cerebral blood flow correlates with heart period and high-frequency heart period variability during working-memory tasks: Implications for the cortical and subcortical regulation of cardiac autonomic activity. Psychophysiology, 41(4), 521–530. https://doi.org/10.1111/1469-8986.2004.00179.x
- McKhann, G. M., Knopman, D. S., Chertkow, H., Hyman, B. T., Jack, C. R., Kawas, C. H., Klunk, W. E., Koroshetz, W. J., Manly, J. J., Mayeux, R., Mohs, R. C., Morris, J. C., Rossor, M. N., Scheltens, P., Carrillo, M. C., Thies, B., Weintraub, S., & Phelps, C. H. (2011). The diagnosis of dementia due to Alzheimer’s disease: Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimer’s and Dementia, 7(3), 263–269. https://doi.org/10.1016/j.jalz.2011.03.005
- Mejía-Arango, S., Miguel-Jaimes, A., Villa, A., Ruiz-Arregui, L., & Gutiérrez-Robledo, L. M. (2007). Deterioro cognoscitivo y factores asociados en adultos mayores en México. Salud Pública de México, 49(S4), 475–481.
- Moss, D. (2004). Heart rate variability and biofeedback. Psychophysiology Today: The Magazine for Mind-Body Medicine, 1, 4–11.
- Organización Mundial de la Salud, (OMS). (2015). Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud.
- Shaffer, F., & Venner, J. (2013). Heart Rate Variability Anatomy and Physiology. Biofeedback, 41(1), 13–25. https://doi.org/10.5298/1081-5937-41.1.05
- Thayer, J. F., Åhs, F., Fredrikson, M., Sollers, J. J., & Wager, T. D. (2012). A meta-analysis of heart rate variability and neuroimaging studies: implications for heart rate variability as a marker of stress and health. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 36(2), 747–756. https://doi.org/10.1016/J.NEUBIOREV.2011.11.009
- Williams, P. G., Cribbet, M. R., Tinajero, R., Rau, H. K., Thayer, J. F., & Suchy, Y. (2019). The association between individual differences in executive functioning and resting high-frequency heart rate variability. Biological Psychology, 148, 107772. https://doi.org/10.1016/J.BIOPSYCHO.2019.107772
Häufig gestellte Fragen zur Herzfrequenzvariabilität (VFC)
1. Was ist die Herzfrequenzvariabilität (VFC)?
Die VFC ist die Schwankung der Intervalle zwischen Herzschlägen. Sie ist ein Indikator für das Gleichgewicht des autonomen Nervensystems und für die Fähigkeit des Körpers, sich an Stress anzupassen.
2. Warum ist die VFC bei älteren Erwachsenen wichtig?
Eine niedrige VFC ist mit einem schlechteren allgemeinen Gesundheitszustand und einem höheren Risiko für kognitiven Abbau verbunden, da sie eine geringere Fähigkeit zur physiologischen und emotionalen Selbstregulation widerspiegelt.
3. Welche kognitiven Funktionen werden durch eine niedrige VFC beeinträchtigt?
Hauptsächlich Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, Verarbeitungsgeschwindigkeit und exekutive Funktionen.
4. Wie wird die VFC in klinischen Umgebungen gemessen?
Sie kann mittels Elektrokardiogramm oder tragbarer Geräte mit Herzfrequenzsensoren gemessen werden, wobei Werkzeuge zur Analyse des Herzrhythmus verwendet werden.
5. Besteht ein Zusammenhang zwischen der VFC und neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer?
Ja, verschiedene Studien deuten darauf hin, dass eine niedrige VFC mit einem erhöhten Risiko für leichten kognitiven Abbau und Alzheimer einhergehen kann, obwohl sie kein alleiniges diagnostisches Marker darstellt.
Wenn Ihnen dieser Blogbeitrag über die Herzfrequenzvariabilität (VFC) und deren Zusammenhang mit kognitivem Abbau gefallen hat, könnten Sie an diesen Artikeln von NeuronUP interessiert sein:
„Dieser Artikel wurde übersetzt. Link zum Originalartikel auf Spanisch:“
La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) y su relación con el deterioro cognitivo



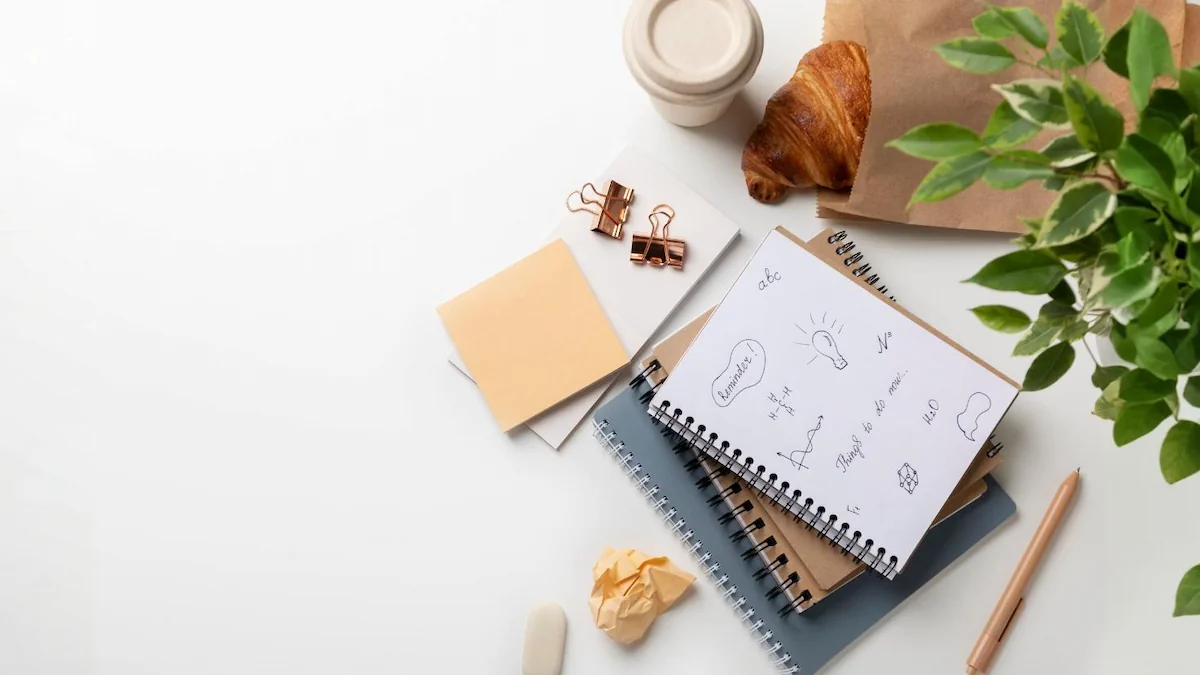



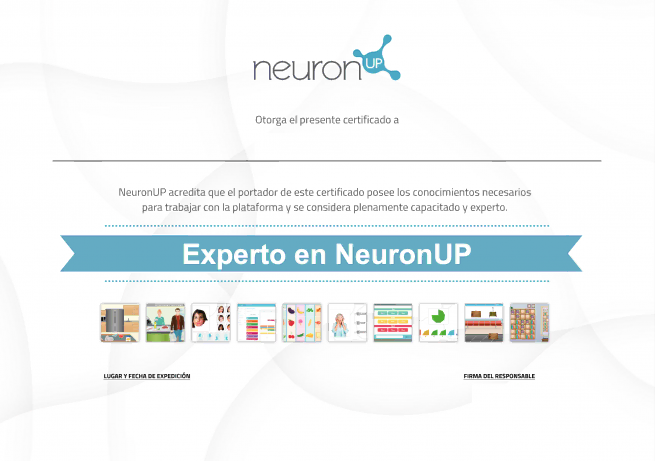 NeuronUP-Zertifikat: 3 einfache Möglichkeiten, dein Zertifikat zu LinkedIn hinzuzufügen
NeuronUP-Zertifikat: 3 einfache Möglichkeiten, dein Zertifikat zu LinkedIn hinzuzufügen
Schreiben Sie einen Kommentar