Ana Isabel Moneo Troncoso, Neuropsychologin, beschreibt in diesem Artikel die Rolle der ischämischen Penumbra, der Neuroimaging-Techniken, der Neuroplastizität und der neuropsychologischen Rehabilitation bei der Genesung nach einem Schlaganfall.
Einleitung
Zerebrovaskuläre Erkrankungen gehören zu den häufigsten Gründen für akute neurologische Konsultationen und stellen ein bedeutendes Problem der öffentlichen Gesundheit dar. Eine der bemerkenswertesten Erkenntnisse ist die Bestätigung, dass neuronale Funktionen nach einer Zeit der Hypoxie wiederhergestellt werden und überleben können. Hervorgehoben wird das potenziell wiederherstellbare Hirngewebe nach der Läsion, das ein therapeutisches Zeitfenster bietet (Zeitraum, in dem die Behandlung am effektivsten sein kann). Dank technologischer Fortschritte in den letzten Jahren gibt es bedeutende Verbesserungen bei der Entwicklung von Rehabilitationsmethoden für ischämische Läsionen.
Zerebrovaskuläre Erkrankung
Die zerebrovaskuläre Erkrankung (ZVE), auch „Schlaganfall“ genannt, bezeichnet die zerebrale Durchblutungsstörung, die eine vorübergehende oder dauerhafte Funktionsstörung einer oder mehrerer Gehirnregionen verursacht. Je nach Art der Läsion wird zwischen ischämisch und hämorrhagisch unterschieden:
- Der hämorrhagische Schlaganfall entsteht durch den Bruch eines Hirngefäßes, wobei Blut außerhalb des Gefäßbettes austritt (Extravasation),
- während der ischämische Schlaganfall (85 % der Fälle) auf einen unzureichenden Blutfluss in einem bestimmten Bereich des Hirnparenchyms aufgrund eines Embolus (Blutgerinnsel) zurückzuführen ist (Ustrell-Roig und Serena-Leal, 2007).
In den ersten Stunden nach Auftreten lassen sich zwei Arten von ischämischen Ereignissen unterscheiden:
- die transitorische ischämische Attacke (neurologisches Defizit, das sich innerhalb von 24 Stunden zurückbildet),
- und der Hirninfarkt (dauerhafte Läsion des Hirnparenchyms), eine Ischämie von ausreichender Dauer, um eine Gewebenekrose zu verursachen (De Celis Ruiz et al., 2023).
Zerebrovaskuläre Erkrankungen gelten als häufige und potenziell tödliche Notfälle, die zweithäufigste Todesursache und die häufigste Ursache für Behinderungen, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) feststellt, und stellen ein ernstes Problem der öffentlichen Gesundheit dar.
Nach einer akuten Läsion gibt es mehrere Zeitfenster, in denen frühzeitige therapeutische Interventionen den Verlauf des Hirninfarkts beeinflussen und eine neuronale Reaktivierung ermöglichen können:
- Zwischen 6 und 8 Stunden ist die Wiederherstellung des Blutflusses im betroffenen Bereich (Reperfusion) entscheidend;
- zwischen 24 Stunden und 17 Tagen ist die neuronale Überlebensrate in der ischämischen Penumbra relevant;
- schließlich begünstigt eine verlängerte therapeutische Konzentration von bis zu drei Monaten die neurofunktionelle Erholung (Sánchez-Chávez, 1999).

Melden Sie sich
für unseren
Newsletter an
Ischämische Penumbra
Die ischämische Penumbra bezeichnet das periphere Hirngewebe, das funktionell beeinträchtigt, aber potenziell wiederherstellbar ist, wenn die zerebrale Ischämie aufgehoben wird. Diese Region wird dank Fortschritten in der Neurorehabilitation als potenziell lebensfähig angesehen. Nach einem ischämischen Ereignis kann die penumbrale Zone aufgrund der Blutversorgung durch Kollateralarterien mehrere Stunden überleben, sodass das Vorhandensein einer Penumbra auf die Möglichkeit einer Zellrettung und eine Verbesserung des klinischen Ergebnisses hindeutet (Ismael, 2009).
Die Techniken der Neurobildgebung, wie die kraniale Magnetresonanztomographie, ermöglichen die Bestätigung und Lokalisierung der Topografie der Läsion und erweisen sich als äußerst nützlich für die Behandlung der Pathologie. In der Akutphase können dank Diffusionssequenzen das infarziertes Gewebe bestimmt sowie die Ausdehnung des Gewebes mittels Perfusionssequenzen quantifiziert werden (Ustrell-Roig und Serena Leal, 2007).
Die positive Diskrepanz zwischen dem Infarktvolumen und dem Volumen der Penumbra (Mismatch) wird als Prädiktor für eine gute Behandlungserfolg verwendet (ein positiver Mismatch weist darauf hin, dass eine große Penumbra im Vergleich zum infarktierten Bereich vorhanden ist, was darauf hindeutet, dass noch potenziell rettbares Gehirngewebe vorhanden ist). Daher ist es von großer Bedeutung, über Neurobildgebungstechniken zu verfügen, die eine Abgrenzung des Infarktkerns und der Penumbrazone ermöglichen, um die Prognose des Patienten vorherzusagen und sie bei therapeutischen Entscheidungen zu verwenden, um Patienten auszuwählen, die von Reperfusionsbehandlungen über die traditionellen Zeitfenster hinaus profitieren könnten (García et al., 2022) (Abbildung 1).

Daher ist die Implementierung sowohl pharmakologischer als auch nicht-pharmakologischer Interventionen, die die Neuroplastizität des Gehirngewebes gewährleisten, von entscheidender Bedeutung in der Post-Schlaganfall-Rehabilitation.
Neuroplastizität
Die Neuroplastizität, aus einer konnektionistischen Perspektive betrachtet, ist die Fähigkeit des Nervensystems zur Modifikation und Regeneration, wodurch das Nervengewebe Veränderungen von Reorganisation oder Anpassung an einen physiologischen Zustand mit oder ohne Veränderung erfahren kann. Dank der Techniken der Gehirn-Neurobildgebung konnte die Gehirnfunktion bestimmt und das Phänomen der Plastizität aufgezeigt werden, das nicht nur auf Kindheit und Jugend beschränkt ist, sondern sich über das gesamte Erwachsenenleben erstreckt (Castillo et al., 2020).
Das Gehirn besitzt eine große Anpassungsfähigkeit an Umstände wie Hirnverletzungen (Post-Läsions-Plastizität) und kompensiert die Schäden durch die Reorganisation und die Schaffung neuer, nicht geschädigter neuronaler Verbindungen, wodurch es zu einer äußerst dynamischen und plastischen Struktur wird (Maurie-Fernández et al., 2010).
Zwischen den ersten Phasen des ischämischen Ereignisses und den folgenden 3-6 Monaten wurden eine Reihe von Prozessen beschrieben, die die Funktionsweise der Plastizität nach der Schädigung bestätigen:
- Erstens tritt eine erhöhte funktionelle Aktivität im somatosensorischen System auf, das der Läsion gegenüberliegt, sowie eine Identifikation von kortikalen Regionen, die mit der betroffenen Zone verbunden sind.
- Zweitens kann es zu einer Stärkung der Struktur der kortikospinalen Bahn auf der ipsilateralen Seite der Läsion kommen, die eine kompensatorische Rolle übernimmt.
- Schließlich wird eine funktionelle Verbindung zwischen den Gehirnhälften und dem sensomotorischen Kortex-Netzwerk auf beiden Seiten des Gehirns wiederhergestellt (Marín-Medina et al., 2023).
Das Phänomen der Plastizität ermöglicht es dem Gehirn, sich neu zu vernetzen und Funktionen auf nicht betroffene Regionen zu übertragen. Dieser Kompensationsmechanismus bildet die neurobiologische Grundlage für Erholungsinterventionen wie die kognitive Stimulation (KS). Dieser Mechanismus ist entscheidend und trägt wesentlich zum Rehabilitations- und Genesungsprozess bei (Castillo et al., 2020).
Neuropsychologische Rehabilitation
Die neuropsychologische Rehabilitation, verstanden als interaktiver Prozess, bezieht sich auf therapeutische Interventionstechniken, die darauf abzielen, kognitive, Verhaltens- und emotionale Defizite nach einer Verletzung zu reduzieren, indem sie die soziale Integration und das Wohlbefinden des Patienten durch ein therapeutisches Team fördert. Hervorzuheben sind die verschiedenen Interventionsmethoden: kognitive Stimulation, familiäre Intervention, Verhaltensmodifikation und berufliche oder berufliche Wiedereingliederung (Murie-Fernández et al., 2010).
In der neuropsychologischen Rehabilitation stechen zwei Ansätze hervor: die Wiederherstellung und die Kompensation der Funktion.
- Der erste Ansatz bezieht sich auf die direkte Intervention bei beeinträchtigten Funktionen mit dem Ziel, eine teilweise oder vollständige Wiederherstellung durch Rehabilitation und wiederholte Übungen zu erreichen.
- Der zweite Ansatz bezieht sich auf das Erlernen neuer Strategien zur Nutzung der erhaltenen kognitiven Fähigkeiten bei Aufgaben, die zuvor die beeinträchtigte Funktion erforderten (CDINC, 2019).
Die Mechanismen, die an der Genesung beteiligt sind, stehen in Zusammenhang mit der Größe und Lokalisation der Verletzung, der betroffenen Region des Kreislaufs und dem Grad der Netzwerkverbindung. Hervorzuheben ist, dass bei einer moderaten Verletzung mit starker Beeinträchtigung der Netzwerkverbindung eine Behandlung, die auf dem erneuten Training der Funktion basiert, äußerst effektiv ist (Marín-Medina et al., 2023).
Ziel der kognitiven Stimulation ist die Optimierung der kognitiven Fähigkeiten zur Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit, durch auf spezifischen Aktivitäten basierende Trainingsprogramme. Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Denken, Sprache oder Gedächtnis sind neuropsychologische Prozesse, die durch kognitive Stimulation verbessert werden können. Allerdings wird auch die affektive, soziale, verhaltensbezogene und familiäre Ebene berücksichtigt, was zu einer ganzheitlichen Intervention beim Individuum führt (Villalba und Espert, 2014).
Dank bedeutender Fortschritte im technologischen Bereich wurden Tools und computergestützte kognitive Trainingsprogramme entwickelt, die eine effektive Rehabilitation ermöglichen. Zu den Hauptvorteilen, die die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in der Rehabilitation bieten, gehören:
- die Personalisierung der Behandlungen entsprechend den spezifischen Bedürfnissen jedes Patienten;
- die Möglichkeit, ein sofortiges Feedback nach der Anwendung zu erhalten, was die Motivation des Patienten fördert;
- die Überwachung der Leistung bei jeder Aufgabe;
- sowie der dynamische Charakter der Aktivitäten (Fernández et al., 2020).
Aus all diesen Gründen stellen IKT einen Meilenstein im Bereich der Rehabilitation dar, verbessern die Lebensqualität von ischämischen Patienten erheblich und machen die Synergie zwischen Technologie und Rehabilitation zu einem bedeutenden Fortschritt.

Möchten Sie unsere Übungen ausprobieren?
Fordern Sie eine Testversion an und arbeiten Sie 7 Tage kostenlos mit NeuronUP
Sie können mit allen unseren Aktivitäten arbeiten, Sitzungen gestalten oder Onlinesitzungen erstellen.
Erfahren Sie mehr über NeuronUP
Kostenlos testen
Mehr als 4.500 Fachkräfte nutzen unsere Plattform bereits täglich.
Fazit
Die Implementierung neuer Technologien in die Rehabilitation von zerebrovaskulären Erkrankungen führt zu einer Optimierung der therapeutischen Prozesse und einer Verbesserung der Ergebnisse, indem sie die Personalisierung der Interventionen erleichtert. Der Beginn der Rehabilitation, ihre Dauer und ihre Intensität sind grundlegende Faktoren, die die funktionelle Genesung des Patienten beeinflussen.
Es ist von größter Bedeutung, dass sowohl die Gesundheitsbehörden als auch die medizinischen Fachkräfte die Aufmerksamkeit auf diese Pathologie priorisieren, da dies ein entscheidender Faktor für die Verbesserung des Gesundheitssystems ist.
Durch die Priorisierung von Prävention, einer frühzeitigen Diagnose und einer schnellen, individualisierten Intervention wird die Belastung des Gesundheitssystems reduziert, während eine umfassende und effektive Versorgung gefördert wird. Die frühzeitige Behandlung von zerebrovaskulären Erkrankungen sollte als grundlegende Strategie für das Wohl der Bevölkerung angesehen werden.
Literaturverzeichnis
- Castillo, G., Fernández, B. und Chamorro, D. (2020). Neuroplastizität: Übungen zur Verzögerung der Auswirkungen der Alzheimer-Krankheit durch kognitive Stimulation. Zeitschrift für wissenschaftliche und technologische Forschung, 4(2), 115-122.
- Zentrum für Diagnostik und neurokognitive Intervention (CDINC). (21. März 2019). Was ist neuropsychologische Rehabilitation? CDINC. https://cdincbarcelona.com/es/que-es-la-rehabilitacion-neuropsicologica/#:~:text=Seg%C3%BAn%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la,adap taci%C3%B3n%20f%C3%ADsica%2C%20psicol%C3%B3gica%20y%20social.
- De Celis Ruiz, E., Masjuan, J., Tejedor, E. D. und De Donlebún, J. R. P. (2023). Ischämischer Schlaganfall. Hirninfarkt und transitorische ischämische Attacke. Medicine-Programm für akkreditierte medizinische Weiterbildung, 13(70), 4083-4094.
- Fernández, E., Fernández und Crespo, M. (2020). Integration von Informations- und Kommunikationstechnologien in die neuropsychologische Intervention. Kubanische Zeitschrift für Gesundheitswissenschaftliche Informationen, 31(2).
- García, M. G., Bea, M. P., Saiz, A. A., Fontaneda, V. D. und Leon, E. C. (2022). Aktualisierung des Schlaganfallcodes in Notaufnahmen. Radiología, 65(31), 3-10.
- Ismael, M. G. (2009). Beitrag von Neurospekt zur Bewertung des ischämischen Schlaganfalls: ischämische Penumbra. Rev. Méd. Clín. Condes, 20(3), 276-281.
- Marín-Medina, D. S., Arenas-Vargas, P. A., Arias-Botero, J. C., Gómez-Vásquez, M., Jaramillo-López, M. F. & Gaspar-Toro, J. M. (2023). Neue Ansätze zur Erholung nach einem Schlaganfall. Neurological Sciences, 45(1), 55-63.
- Murie-Fernández, M., Irimia, P., Martínez-Vila, E., John Meyer, M., und Teasell, R. (2010). Neurorehabilitation nach einem Schlaganfall. Neurología, 25(3), 189–196.
- Ustrell-Roig, X. und Serena-Leal, J. (2007). Schlaganfall. Diagnostik und Behandlung zerebrovaskulärer Erkrankungen. Revista Española de Cardiología, 60(7), 753-769.
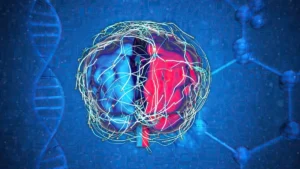



 Aktuelle Trends in der Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen
Aktuelle Trends in der Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen
Schreiben Sie einen Kommentar