Martha Valeria Medina Rivera, Neuropsychologin bei NeuronUP, erklärt uns wie die Diaschisis die kognitiven Folgen nach einem TCE beeinflusst und welche Schlüsselrolle die Neuropsychologie bei deren Rehabilitation spielt.
Einleitung
Das traumatische Schädel-Hirn-Trauma (TCE) ist eine der Hauptursachen für Behinderungen und Mortalität weltweit. Zu den häufigsten Ursachen gehören Stürze und Verkehrsunfälle; letztere haben in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ein deutlich größeres Gewicht und machen dort bis zu 56 % der Fälle aus, im Vergleich zu 25 % in Ländern mit hohem Einkommen, da die Verkehrssicherheit und -regulierung jedes Landes ihre Häufigkeit bestimmen. Global betrachtet wird geschätzt, dass jährlich etwa 69 Millionen TCE auftreten, mit einer drei Mal höheren Belastung in Ländern mit geringen Ressourcen (Halalmeh et al., 2024).
Dieses Bild spiegelt die Komplexität des TCE wider, insbesondere bei Verkehrsunfällen, bei denen die Verletzungen nicht nur fokale Schäden verursachen, sondern auch funktionelle Fernverbindungen unterbrechen. Hier tritt das Konzept der Diaschisis in den Vordergrund, das entscheidend dafür ist zu verstehen, warum viele kognitive Störungen nicht ausschließlich von der geschädigten Region abhängen, sondern von der Disconnection größerer neuronaler Netzwerke.
Daher ist das Ziel dieses Artikels, die Beziehung zwischen TCE durch Verkehrsunfälle und dem Phänomen der Diaschisis sowie die Rolle der Neuropsychologie als zentraler Bestandteil zur Optimierung von Interventionsstrategien und zur Verbesserung der funktionellen Prognose betroffener Personen zu analysieren.
Traumatisches Schädel-Hirn-Trauma (TCE)
Ein TCE wird verstanden als eine strukturelle Verletzung oder eine physiologische Störung der Hirnfunktion, verursacht durch eine äußere Kraft (Mckee & Daneshvar, 2015).
Laut der klinischen Leitlinie des US Department of Veterans Affairs und des Department of Defense (VA/DoD, 2009 in Mckee & Daneshvar, 2015) wird die Diagnose gestellt, wenn mindestens eine der folgenden Manifestationen beobachtet wird: Verlust oder Veränderung des Bewusstseins, posttraumatische Amnesie, Verwirrung oder verlangsamtes Denken, vorübergehende oder persistente neurologische Veränderungen sowie der Nachweis einer intrakraniellen Verletzung.
Die Schwere des TCE wird hauptsächlich mittels der Glasgow Coma Scale (GCS), der Dauer des Bewusstseinsverlusts (LOC) und der posttraumatischen Amnesie (PTA) klassifiziert:
- Leicht: GCS 13–15, LOC < 1 h, PTA < 24 h.
- Mittelgradig: GCS 9–13, LOC 1–24 h, PTA 1–7 Tage.
- Schwer: GCS 3–8, LOC > 24 h, PTA > 1 Woche.
Obwohl die Mehrheit der Fälle (75–85 %) leicht sind, entwickeln zwischen 15–30 % der Betroffenen persistierende Symptome, die Kognition, Verhalten und emotionalen Zustand beeinträchtigen und zeigen, dass selbst die mildesten Formen langfristige Folgen haben können (Mckee & Daneshvar, 2015).

Melden Sie sich
für unseren
Newsletter an
Zusammenhang zwischen kognitiven Störungen und spezifischer Hirnschädigung nach TCE
Die kognitiven und Verhaltensänderungen nach einem TCE sind häufig und beeinträchtigen das tägliche Leben erheblich (MckKee & Daneshvar, 2015; Halalmeh et al., 2024). Um diese Komplexität zu verstehen, ist es notwendig, die Verletzungsmechanismen und die neurophysiologischen Prozesse zu beschreiben, die dem TCE zugrunde liegen, insbesondere im Kontext von Verkehrsunfällen (Azouvi et al., 2017; Le Prieult et al., 2017; Halalmeh et al., 2024).
Bei einem Aufprall ist das Gehirn Beschleunigungs‑/Verzögerungskräften, direkten Stößen und Rotationsbewegungen ausgesetzt (Azouvi et al., 2017). Diese Mechanismen verursachen zwei Haupttypen von Schäden:
- Fokale Läsionen: Entzündungen, Kontusionen, Hämatome oder innere Blutungen, die hauptsächlich frontale und temporale Regionen betreffen (Mckee & Daneshvar, 2015).
- Difuse Läsionen: betreffen die weiße Substanz, insbesondere den Corpus callosum und Verbindungsbahnen frontostriataler sowie temporoparietaler Trakte und stören großräumige neuronale Netzwerke (Mckee & Daneshvar).
Dazu kommt eine Kaskade von sekundären Prozessen, die die Veränderungen im Gehirn verstärken: Exzitotoxizität durch überschüssiges Glutamat, mitochondrialer Funktionsverlust, oxidativer Stress, reduzierte zerebrale Durchblutung, Ödeme, Neurotransmitter-Ungleichgewichte und mikroglia-vermittelte Neuroinflammation (mit sowohl schädlichen als auch reparativen Effekten) (Mckee & Daneshvar, 2015).
Fokale Läsionen, diffuse Schäden und sekundäre Prozesse bilden die neurobiologische Grundlage der nach einem TCE beobachteten kognitiven und Verhaltensschwierigkeiten. Die häufigsten kognitiven Folgen sind meist mit den durch die Verletzung betroffenen Arealen assoziiert und umfassen Schwierigkeiten (Halalmeh et al., 2024).
Diaschisis und ihre Beziehung zum TCE
Wie gesehen, kann ein TCE Hirnregionen schädigen, die an bestimmten kognitiven Funktionen beteiligt sind; jedoch wissen wir heute, dass es keinen strikten Lokalisationismus gibt, der eine Funktion ausschließlich einer Zone zuordnet. Das Gehirn funktioniert als ein vernetztes System, und häufig treten kognitive Störungen auf, obwohl die Läsion nicht in der Region liegt, die üblicherweise mit diesen Funktionen in Verbindung gebracht wird.
Dieses Phänomen, 1914 von von Monakow als Diaschisis beschrieben, besteht in einer Verminderung der neuronalen Erregbarkeit in weit entfernten Bereichen der Läsion aufgrund der Unterbrechung von Verbindungswegen (Carrera & Tononi, 2014).
Die Diaschisis wirkt wie eine Abwehrstrategie: nach der Verletzung treten weite Regionen in einen Zustand der Hypoexzitabilität oder „Schockphase“ ein, der sich je nach Ausdehnung des Schadens und der neuronalen Plastizität schrittweise zurückbilden kann. Dieses Phänomen erklärt, warum einige Personen motorische, sensorische oder kognitive Veränderungen zeigen, die nicht mit dem anatomisch geschädigten Bereich übereinstimmen, da dies nicht nur die Kortexregionen, sondern auch tiefe Strukturen wie den Thalamus und das Kleinhirn betreffen kann, die für motorische und kognitive Organisation von zentraler Bedeutung sind (Sarmati, 2022).
In Tiermodellen wurde zudem eine akute transhemisphärische Diaschisis beschrieben, gekennzeichnet durch eine vorübergehende kontralaterale Überaktivität in den ersten 24–48 Stunden, was die Möglichkeit früher Interventionen zur Modulation neuronaler Plastizität eröffnet (Le Prieult et al., 2017).
Kürzlich wurde vorgeschlagen, dass die Diaschisis auch metabolische Anpassungen umfasst. Boggs et al. (2024) beschreiben ein Muster fokaler metabolischer Diaschisis, bei dem Regionen, die der Läsion gegenüberliegen, biochemische Veränderungen zeigen, die offenbar auf eine Verbesserung der mitochondrialen Funktion, die Reduktion von oxidativem Stress, die Erhaltung der neuronalen Integrität und die Verhinderung glialer Degeneration abzielen. Dieser Befund unterstreicht, dass die Diaschisis auch als Schutzmechanismus wirken kann, indem sie den Energiestoffwechsel moduliert, um die durch die initiale TCE-Schädigung verursachte Dysfunktion zu kompensieren.
Es ist wichtig, das Phänomen der Diaschisis von distalen Läsionen wie axonalem diffusen Schaden zu unterscheiden, der durch Dehnungskräfte verursacht wird, die die axonalen Membranen direkt schädigen (Azouvi et al., 2017; Le Prieult et al., 2017; Halalmeh et al., 2024), da bei der Diaschisis der Fokus hauptsächlich auf funktioneller Disconnection und nicht auf einem tatsächlichen Riss liegt (Le Prieult et al., 2017).
Daher ist das Verständnis der Diaschisis entscheidend, um zu erklären, warum kognitive und emotionale Schwierigkeiten nach einem TCE nicht ausschließlich von der primären Läsion abhängen, sondern von einem netzwerkweiten Effekt, der die globale Effizienz des Gehirns beeinträchtigt. Klinisch kann dieser Zustand Wochen, Monate oder sogar ein Leben lang andauern, was die Bedeutung unterstreicht, die zerebrale Reorganisation mit geeigneten neurokognitiven Interventionen zu steuern, die die zeitlichen Abläufe des Nervensystems respektieren (Sarmati, 2022).
Testen Sie NeuronUP 7 Tage kostenlos
Probieren Sie unsere verschiedenen Übungen, erstellen Sie Sitzungen oder arbeiten Sie remote mithilfe von Online-Sitzungen
Kognitive Schwierigkeiten nach einem TCE und die Rolle der Diaschisis
Die kognitiven und verhaltensbezogenen Folgen eines traumatischen Schädel-Hirn-Traumas (TCE) sind vielfältig und hängen sowohl von der direkten Schädigung als auch von sekundären Prozessen ab, die die Dynamik neuronaler Netzwerke beeinflussen. Unter diesen ist die Diaschisis besonders relevant, da sie erklärt, wie weit entfernte Funktionen durch die funktionelle Disconnection miteinander verknüpfter Schaltkreise betroffen sein können (Carrera & Tononi, 2014).
Gedächtnisstörungen nach einem TCE
Gedächtnisstörungen gehören zu den hartnäckigsten nach einem TCE. Das episodische Gedächtnis ist durch langsameres Lernen, beschleunigtes Vergessen und erhöhte Anfälligkeit für Interferenzen gekennzeichnet; ebenso zeigen das prospektive und das autobiografische Gedächtnis bedeutende Schwierigkeiten (Halalmeh et al., 2024). Diese Veränderungen spiegeln nicht nur direkte Schäden in frontotemporalen Regionen wider, sondern können auch Folge einer Disconnection zwischen dem Hippokampus und den präfrontalen Arealen durch Diaschisis sein, was die effiziente Enkodierung und den Abruf von Informationen beeinträchtigt.
Aufmerksamkeits- und Verarbeitungsgeschwindigkeitsstörungen nach einem TCE
Personen mit TCE zeigen häufig Probleme mit der aufmerksamen, anhaltenden, geteilten und selektiven Aufmerksamkeit, oft begleitet von mentaler Ermüdung. Obwohl dies meist mit diffusem axonalem Schaden in Verbindung gebracht wird, kann es auch durch die Hypoexzitabilität frontoparietaler Netzwerke infolge der Diaschisis erklärt werden, die die Fähigkeit einschränkt, Aufmerksamkeitsressourcen effektiv zu verteilen (Le Prieult et al., 2017). Parallel dazu ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit selbst bei einfachen Aufgaben verlangsamt, nicht nur durch strukturelle Beeinträchtigungen der weißen Substanz, sondern auch durch die Unterbrechung der interhemisphärischen Konnektivität (Azouvi et al., 2017).
Exekutive Funktionsstörungen nach einem TCE
Auch die exekutiven Funktionen sind nach einem TCE beeinträchtigt. Obwohl direkte frontale Schäden ein offensichtlicher Faktor sind, erklärt die Diaschisis, warum auch Läsionen in temporalen oder subkortikalen Bereichen exekutive Störungen hervorrufen können: Wird die Kommunikation mit präfrontalen Netzwerken unterbrochen, nimmt die Schwierigkeit der Selbstregulation und der funktionellen Anpassungsfähigkeit zu (Halalmeh et al., 2024).
Schließlich können nach einem TCE auch soziale Kognition und Verhalten Schwierigkeiten beim Erkennen von Emotionen und bei der Interpretation sozialer Hinweise aufweisen, was direkte Auswirkungen auf zwischenmenschliche Beziehungen hat.
Darüber hinaus können Verhaltensänderungen wie Enthemmung, Impulsivität und Reizbarkeit sowie Apathie oder mangelnde Initiative auftreten, was die familiäre, soziale und berufliche Wiedereingliederung beeinträchtigt (Azouvi et al., 2017). Hier spielt die Diaschisis eine erklärende Rolle, indem sie zeigt, wie Veränderungen in verteilten Netzwerken — über die fokale Läsion hinaus — komplexe soziale und emotionale Prozesse beeinflussen.
Die Bedeutung der Neuropsychologie im Umgang mit TCE
Angesichts der Komplexität der bereits erwähnten strukturellen und funktionellen Veränderungen, die oft durch Diaschisis moduliert werden, spielt die Neuropsychologie sowohl in der Diagnostik als auch in der Intervention eine zentrale Rolle. Halalmeh et al. (2024) heben die Bedeutung der Interventions-Neuropsychologie hervor, um die Progression zu einem postkommotionellen Syndrom (PCS) und anderen persistierenden Veränderungen zu verhindern. Selbst bei leichten TCE entwickeln einige Personen anhaltende Symptome wie Kopfschmerzen, Gedächtnisprobleme oder emotionale Veränderungen.
Frühe psychoedukative Interventionen haben sich als wirksam erwiesen, um die Chronifizierung von Symptomen zu reduzieren, negative Erwartungen zu verändern und die schrittweise Wiedereingliederung in Aktivitäten zu unterstützen. Gleichzeitig ermöglichen Programme zur kognitiven Rehabilitation, Funktionen wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis und exekutive Funktionen durch personalisiertes Training zu stärken. Diese Maßnahmen werden durch Psychotherapie, insbesondere die kognitiv-behaviorale Therapie, ergänzt, die hilft, emotionale und verhaltensbezogene Symptome im Zusammenhang mit dem TCE zu bewältigen.
Dieser ganzheitliche Ansatz verbessert nicht nur die funktionelle Prognose, sondern optimiert auch die Nutzung von Gesundheitsressourcen und reduziert den Bedarf an invasiveren Interventionen in späteren Phasen.
Fazit
Das TCE bei Verkehrsunfällen ist ein neurologisches Ereignis von großer Komplexität mit Folgen, die weit über den sichtbaren fokalen Schaden hinausgehen. Die Einbeziehung des Konzepts der Diaschisis hilft besser zu verstehen, warum kognitive und verhaltensbezogene Schwierigkeiten nicht immer direkt mit dem geschädigten Bereich korrespondieren, sondern die Beeinträchtigung vernetzter Hirnnetzwerke widerspiegeln.
Dieses Phänomen, das nicht nur funktionelle Inhibitionsprozesse, sondern auch metabolische Anpassungen umfasst, zeigt, dass das Gehirn auf Verletzungen sowohl mit Verwundbarkeits- als auch mit Kompensationsmechanismen reagiert. So können Funktionen wie Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Verarbeitungsgeschwindigkeit oder exekutive Funktionen beeinträchtigt sein, selbst wenn keine direkte Läsion in den traditionell damit assoziierten Bereichen vorliegt.
Insgesamt erinnert uns das Studium von TCE und Diaschisis daran, dass das Gehirn als ein vernetztes System arbeitet. Die Anerkennung dieser Perspektive ist entscheidend, um zu realistischeren Erklärungsmodellen für die globalen Auswirkungen dieser Verletzungen zu gelangen.
Daher ist ein interdisziplinäres Modell, in dem Neuropsychologie, Neurologie, Physiotherapie und Ergotherapie eng zusammenarbeiten, unerlässlich. In diesem Sinne ist es wichtig zu betonen, dass die Neuropsychologie eine wesentliche Rolle bei der Bewertung und Intervention nach einem TCE spielt, da sie ermöglicht, die betroffenen Funktionen präzise zu identifizieren und zu verstehen, wie sie mit Phänomenen der zerebralen Disconnection interagieren; dadurch erhält man nicht nur das kognitive Profil jeder Person, sondern schafft auch die Grundlage für die Entwicklung individualisierter und fundierter Behandlungsstrategien.
Literatur
- Azouvi, P., Arnould, A., Dromer, E., & Vallat-Azouvi, C. (2017). Neuropsychology of traumatic brain injury: An expert overview. Revue Neurologique, 173(7), 461–472. https://doi.org/10.1016/j.neurol.2017.07.006
- Boggs, R. C., Watts, L. T., Fox, P. T., & Clarke, G. D. (2024). Metabolic diaschisis in mild traumatic brain injury. Journal of Neurotrauma, 41(13–14), e1793–e1806. https://doi.org/10.1089/neu.2023.0290
- Carrera, E., & Tononi, G. (2014). Diaschisis: Past, present, future. Brain, 137(9), 2408–2422. https://doi.org/10.1093/brain/awu101
- Halalmeh, D. R., Salama, H. Z., LeUnes, E., Feitosa, D., Ansari, Y., Sachwani-Daswani, G. R., & Moisi, M. D. (2024). The role of neuropsychology in traumatic brain injury: Comprehensive literature review. World Neurosurgery, 183, 128–143. https://doi.org/10.1016/j.wneu.2023.12.069
- Le Prieult, F., Thal, S. C., Engelhard, K., Imbrosci, B., & Mittmann, T. (2017). Acute cortical transhemispheric diaschisis after unilateral traumatic brain injury. Journal of Neurotrauma, 34(5), 1097–1110. https://doi.org/10.1089/neu.2016.4575
- Mckee, A. C., & Daneshvar, D. H. (2015). The neuropathology of traumatic brain injury. Handbook of Clinical Neurology, 127, 45–66. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52892-6.00004-0
- Sarmati, V. (2022.). Diasquisis. Stroke Therapy Revolution. Abgerufen am 25. August 2025, von https://www.stroke-therapy-revolution.es/diasquisis/
- Wiley, C. A., Bissel, S. J., Lesniak, A., Dixon, C. E., Franks, J., Beer Stolz, D., Sun, M., Wang, G., Switzer, R., Kochanek, P. M., & Murdoch, G. (2016). Ultrastructure of diaschisis lesions after traumatic brain injury. Journal of Neurotrauma, 33(20), 1866–1882. https://doi.org/10.1089/neu.2015.4272
Häufig gestellte Fragen zum TCE und zur Diaschisis
1. Was ist ein traumatisches Schädel-Hirn-Trauma (TCE)?
Ein traumatisches Schädel-Hirn-Trauma ist eine Verletzung des Gehirns, die durch eine äußere Kraft wie einen Schlag, Ruck oder direkten Aufprall auf den Kopf verursacht wird. Es kann leicht, mittelgradig oder schwer sein, je nach Bewusstseinslage, Dauer der Amnesie und Vorhandensein struktureller Schäden.
2. Was ist Diaschisis und wie hängt sie mit dem TCE zusammen?
Diaschisis ist ein Phänomen, bei dem weit entfernte Gehirnareale ihre Aktivität verringern, weil neuronale Netzwerke funktionell getrennt sind. Bei einem TCE erklärt es, warum Defizite in Regionen auftreten können, die nicht direkt verletzt wurden.
3. Welche kognitiven Folgen sind nach einem TCE am häufigsten?
Zu den häufigsten Folgen gehören Beeinträchtigungen des Gedächtnisses, der Aufmerksamkeit, der Verarbeitungsgeschwindigkeit, der exekutiven Funktionen und der sozialen Kognition. Diese können das tägliche Leben und die soziale sowie berufliche Wiedereingliederung dauerhaft beeinträchtigen.
4. Warum ist die Neuropsychologie bei der Behandlung von TCE wichtig?
Die Neuropsychologie bewertet die kognitiven und emotionalen Auswirkungen des TCE und implementiert personalisierte Programme zur kognitiven Rehabilitation, Psychoedukation und verhaltenstherapeutischen Maßnahmen, um die funktionelle Erholung zu fördern und chronische Folgeschäden zu verhindern.
5. Welche Techniken der kognitiven Stimulation werden in der Rehabilitation nach TCE eingesetzt?
Es werden Trainingsprogramme zur kognitiven Verbesserung eingesetzt, die sich auf Gedächtnis, Aufmerksamkeit und exekutive Funktionen konzentrieren und an die Bedürfnisse der Betroffenen angepasst sind, kombiniert mit Psychotherapie, kompensatorischen Techniken und interdisziplinärer Unterstützung (Physiotherapie und Ergotherapie).
Wenn Ihnen dieser Artikel über das traumatische Schädel-Hirn-Trauma durch Verkehrsunfälle und Diaschisis: neuropsychologische Auswirkungen gefallen hat, könnten Sie sich für diese Artikel von NeuronUP interessieren:
„Dieser Artikel wurde übersetzt. Link zum Originalartikel auf Spanisch:“
Traumatismo craneoencefálico por accidente automovilístico y diasquisis: impacto neuropsicológico



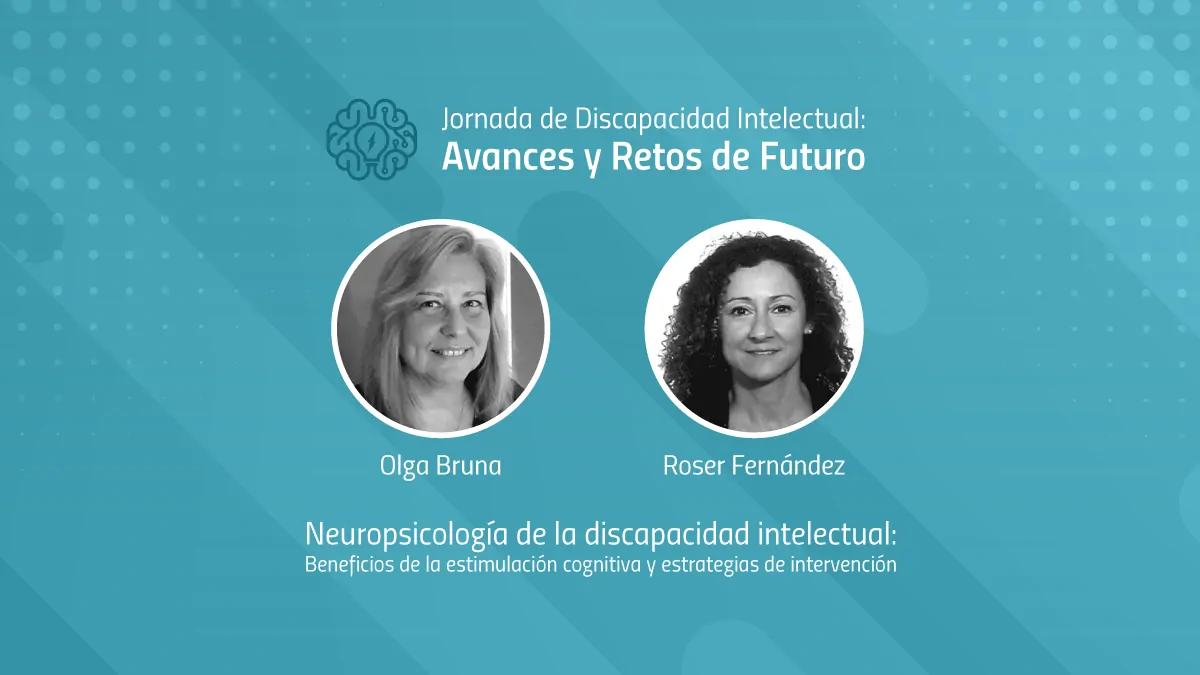



 Exekutive Funktionen: Was sie sind, welche Rolle sie spielen und wie man sie verbessert
Exekutive Funktionen: Was sie sind, welche Rolle sie spielen und wie man sie verbessert
Schreiben Sie einen Kommentar