Die Erforschung des Bewusstseins bleibt ein Rätsel für die moderne Wissenschaft. Sie wird jedoch zunehmend zu einem Schlüsselfaktor für die Genesung von Patienten mit erworbener Hirnschädigung. Viele neuropsychologische Rehabilitationsprozesse scheitern, weil die Mitarbeit des Patienten fehlt: Er hält sich nicht an die vorgeschriebenen Richtlinien, verweigert Gruppensitzungen oder erscheint nicht zu den geplanten Konsultationen. Dies geschieht nicht aus Mangel an Willen oder Verständnis, sondern ist Teil einer neuropsychologischen Störung, die dazu führt, dass der Patient sein Defizit nicht wahrnimmt und so handelt, als sei alles in Ordnung.
Was ist Bewusstsein?
Bewusstsein ist ein äußerst komplexes Konstrukt. Dass wir heute keine eindeutige Definition dieser mentalen Funktion haben, liegt vermutlich an ihrer außergewöhnlichen Allgegenwart im Gehirn und ihrer facettenreichen Natur. Der britische Philosoph John Locke (1632–1704) definierte Bewusstsein als die „Wahrnehmung dessen, was im eigenen Geist vor sich geht“. Modernere Definitionen besagen, dass Bewusstsein ein „privater, persönlicher, subjektiver und qualitativer Geisteszustand“ ist, der mehrere persönliche Erfahrungen (Qualia) auf einheitliche, kohärente und kontinuierliche Weise integriert.

Melden Sie sich
für unseren
Newsletter an
Unterschiede zwischen ‘bei Bewusstsein sein’ und ‘sich bewusst sein’
Eine nützliche Unterscheidung ist die im Spanischen zwischen ‘estar consciente’ und ‘ser consciente’. ‘Estar consciente’ entspricht dem Wach- und Aufmerksamsein, empfänglich für Umgebungsreize – Bewusstsein im Sinne dessen, was man hat, wenn man wach ist, und was man verliert, wenn man tief schläft oder unter Anästhesie steht. Dagegen bezeichnet ‘ser consciente’ eher die Fähigkeit des Menschen, das eigene Denken zu erkennen und die Welt sowie sich selbst objektiv zu begreifen, während gleichzeitig ein Gefühl von Subjektivität erhalten bleibt.
Diese Eigenschaften des Bewusstseins hätten eine identifizierbare neuroanatomische Basis im Gehirn, obwohl das Wissen über deren neuronale Lokalisation noch recht unsicher ist. Um wach zu bleiben, benötigen wir Aktivierung und Wachheit, grundlegende Funktionen, die von Strukturen im Hirnstamm, dem aufsteigenden retikulären Aktivierungssystem (S.A.R.A.) und fronto-parietalen noradrenergen Bahnen abhängen, die beim spezifischen Bezug auf das Arousal im rechten Hemisphäre lateralisiert sind. Die Fähigkeit, den Aufmerksamkeitsfokus auf eine bestimmte Wahrnehmung zu richten, beruht auf hinteren parietalen Arealen und einigen thalamischen Kernen wie dem Pulvinar. Die Erzeugung bewusster Erfahrungen wurde mit reverberierenden kortiko-thalamischen Schaltkreisen in Verbindung gebracht, konsistent in synchronisierten neuronalen Entladungsraten bei 40 Hertz. Schließlich wäre das Selbstbewusstsein – also das Substrat der Selbstreflexion, Identität und der Theory of Mind – im präfrontalen Kortex verortet.
Wie wir sehen, ist Bewusstsein kein einheitliches Konstrukt. Vielmehr, wie bereits in der Philosophie unterschieden wurde, existieren verschiedene Formen des Bewusstseins mit unterschiedlichen neuroanatomischen Grundlagen, die dazu beitragen, die bewussten Erfahrungen und das Selbstbewusstsein zu erzeugen, die wir im Alltag haben.

Fehlendes Bewusstsein der Defizite: Anosognosie
Eines der Dinge, die angehende Neuropsychologen am meisten überraschen, ist das fehlende Bewusstsein der Defizite bei Patienten mit erworbener Hirnschädigung. Patienten mit Wernicke-Aphasie, die glauben, kohärent zu sprechen und verstanden zu werden, Patienten mit Hemineglect, die gegen Türen stoßen oder die Nahrung auf der kontralateralen Seite des Tellers nicht essen, sowie Patienten mit schweren Problemen der emotionalen Selbstregulation und Einsicht nach einer Frontalhirnschädigung, die jegliche Probleme leugnen, sind in neuropsychologischen Praxen häufige Fälle. All dies stellt eine Herausforderung für den Kliniker sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapieplanung dar.
Was ist Anosognosie?
Der Begriff Anosognosie wurde erstmals 1914 vom französischen Neurologen Charles Babinski geprägt, als er einen Hemiplegie-Fall beschrieb, bei dem der Patient sein Defizit nicht wahrnahm. Später wurde der Begriff „Anosognosie“ populär und erweitert, um allgemein das Fehlen des Bewusstseins für Defizite zu bezeichnen – seien diese physischer, kognitiver, emotionaler, zwischenmenschlicher oder persönlicher Natur.
Die Anosognosie oder das fehlende Bewusstsein der Defizite ist eine häufig beobachtete Störung bei Patienten mit Hirnschädigungen, sei es traumatisch, infolge eines Schlaganfalls, eines Tumors oder einer Infektion. Ihre Prävalenz liegt laut verschiedenen Studien zwischen 33 % und 52 %. Zudem zeigen etwa die Hälfte der Patienten ein Jahr nach der Hirnschädigung noch dieses Defizit. Ihr Vorhandensein stellt einen negativen Prognosefaktor dar, da es meist zu Motivationsmangel, geringer Therapietreue, geringer Teilnahme an geplanten Aktivitäten und Diskrepanzen zwischen den Selbstwahrnehmungserwartungen des Patienten und der Realität führt.
Therapeutischer Ansatz bei fehlendem Bewusstsein für Defizite nach erworbener Hirnschädigung
Bei der Planung eines neuropsychologischen Interventionsprogramms empfiehlt es sich, eine Reihe von Prinzipien zu befolgen, die dabei helfen, die bestmögliche Intervention an die spezifischen Bedürfnisse des Patienten anzupassen. Dazu gehören das Zurückgreifen auf theoretische Bezugsmodelle zur Interpretation der Testergebnisse, eine interdisziplinäre und vielfältige Perspektive sowie die Fokussierung der Rehabilitation mehr auf die Behinderung als auf die Defizite. Dies beinhaltet in der Regel eine gründliche Analyse der funktionalen Auswirkungen, die die erworbene Hirnschädigung auf das Leben des Patienten hatte, und das Bemühen um eine bestmögliche sozioberufliche Anpassung.
Das fehlende Bewusstsein für Defizite kann den Alltag von Menschen mit neuropsychologischen Störungen erheblich beeinträchtigen und die Therapietreue behindern. Daher wird der therapeutische Ansatz des fehlenden Bewusstseins für Defizite im Kontext einer erworbenen Hirnschädigung, sofern er vorliegt, zum ersten therapeutischen Ziel bei der Behandlungsplanung.
Die meisten Interventionsprogramme zur Verbesserung des Bewusstseins für Defizite verfolgen gemeinsame Ziele: das Kenntnis der Schädigung seitens des Patienten zu erhöhen, die Anerkennung seiner Einschränkungen zu fördern und die Diskrepanz zwischen seinen Funktionserwartungen und seiner tatsächlichen Leistungsfähigkeit zu verringern. Zudem ist der Aufbau einer guten therapeutischen Beziehung in diesem Prozess entscheidend, insbesondere da der Patient beim zunehmenden Bewusstsein seiner Defizite Symptome wie Depression, Angst oder sogar Verleugnung zeigen kann.

Melden Sie sich
für unseren
Newsletter an
Interventionsstrategien zur Rehabilitation des Bewusstseins für Defizite bei erworbener Hirnschädigung
In einer aktuellen systematischen Übersichtsarbeit legen Villalobos und Mitarbeiter (2020) die am häufigsten eingesetzten Interventionsstrategien in der Rehabilitation des Bewusstseins für Defizite bei erworbener Hirnschädigung dar: Psychoedukation, Feedback, Konfrontierung, Verhaltenstherapie und Psychotherapie.
Psychoedukation
Mit Hilfe der Psychoedukation werden dem Patienten Informationen an seine Verständnisfähigkeit angepasst über die Natur seiner Störung, die damit verbundenen Defizite und ihre funktionalen Auswirkungen vermittelt, mit dem Ziel, sein Wissen über sein Problem zu vertiefen.
Feedback
Das Ziel des Feedbacks ist es, den Patienten über seine Leistung in einer konkreten Aufgabe zu informieren. Dies ermöglicht ihm einzuschätzen, ob er das Ziel erreicht hat oder wie weit er davon entfernt ist, um seine Leistung anzupassen oder geeignete Strategien zu entwickeln.
Konfrontierung
Die Konfrontierung wird genutzt, um die Diskrepanz zwischen den Erwartungen des Patienten und seiner tatsächlichen Leistung in einer Aufgabe zu messen. Hierfür werden strukturierte Aufgaben entworfen, die Selbstkontrolle und Selbstevaluation ermöglichen, basierend auf den aktuellen Fähigkeiten des Patienten. Der Patient soll vor der Aufgabe eine Schätzung seiner Leistung abgeben und diese anschließend mit dem erzielten Ergebnis vergleichen. Der erlebte Versuch hat meist großen Einfluss auf das Bewusstsein der Patienten für ihre neue Realität. Daher ist Vorsicht geboten: Vor- und Nachteile dieser Interventionsform sollten sorgfältig abgewogen und der passende Zeitpunkt im Rehabilitationsprozess gewählt werden.
Verhaltenstherapie
Vermuten wir, dass die Konfrontierung beim Patienten Angst auslösen oder psychisch schädlich sein könnte, ist es ratsam, zunächst mit dem Training kompensatorischer Strategien zu beginnen und prozedurale Gewohnheiten zu fördern, die dem Patienten mehr Funktionalität verleihen.
Psychotherapie
Psychotherapie kann in verschiedenen Phasen der Erholung von einer erworbenen Hirnschädigung hilfreich sein, besonders wenn fehlendes Bewusstsein für Defizite eine Rolle spielt. In der Fachwelt ist die Ätiologie der Anosognosie umstritten: Sie könnte neurologische Ursachen haben, aber auch psychologische Mechanismen der Verleugnung einschließen. In jedem Fall kann Psychotherapie sowohl helfen, mit den emotionalen Störungen umzugehen, die solche Defizite mit sich bringen, als auch einen neuen Sinn im Leben zu finden und neue, der veränderten Realität angepasste Ziele zu entwickeln.
Schlussfolgerungen zum Bewusstsein der Defizite als Schlüsselfaktor bei der Genesung nach erworbener Hirnschädigung
Der therapeutische Ansatz des fehlenden Bewusstseins für Defizite weckt sowohl bei Forschenden als auch bei Neuropsychologen zunehmendes Interesse. Wie wir gesehen haben, kann die Rehabilitation einer kognitiven, emotionalen oder Verhaltensstörung nach einer erworbenen Hirnschädigung deutlich erschwert sein, wenn der Patient sich seines Defizits nicht bewusst ist. Zahlreiche Studien haben die prognostische Aussagekraft des fehlenden Bewusstseins für Defizite für die Reintegration von Patient:innen mit erworbener Hirnschädigung hervorgehoben. Tatsächlich gilt: Je geringer das Bewusstsein für das Defizit, desto schlechter die Reintegration.
Aus diesem Grund wird die Entwicklung neuer theoretischer Modelle, Messinstrumente und Rehabilitationsprogramme immer notwendiger, um den Patient:innen die besten, an ihre Störung angepassten therapeutischen Werkzeuge bieten zu können. Es ist offensichtlich, dass wir diese Aspekte bereits in gewisser Form bearbeiten, doch sollte dies auf eine systematischere und strukturiertere Weise erfolgen. Nur so können wir das Verständnis der Prozesse der Bewusstseinsmonitorierung vertiefen und zur Entwicklung einer evidenzbasierten Neuropsychologie beitragen.
Literaturhinweise zu erworbener Hirnschädigung und Bewusstsein der Defizites
Adolphs, R. (2015). The unsolved problems of neuroscience. Trends in Cognitive Science, 19(4) 173-75.
Aznar-Casanova, J.A. (2017). La consciencia: la interfaz polinómica de la subjetividad. Madrid: Pirámide.
Locke, J. (1690/1980). Ensayo sobre el entendimiento humano. Editora Nacional, Madrid.
Flashman, L. A. & McAllister, T.W. (2002). Lack of awareness and its imact in traumatic brain injury. Neurorrehabilitation, 17(4), 185-96.
Graziano, M. (2015). Consciousness and the social brain. New York: Oxford University Press.
González, B., Paúl, N., Blázquez, J. L. & Ríos, M. (2006). Factores relacionados con la falta de consciencia de los déficits en el daño cerebral. Acción Psicológica, 4(3), 87-99.
Muñoz-Céspedes, J.M. & Tirapu-Ustárroz, J. (2001). Rehabilitación neuropsicológica. Madrid: Síntesis
Robertson, K. & Schmitter-Edgecombe, M. (2015). Self-awareness and traumatic brain injury outcome, Brain Injury, 29:7-8, 848-858, DOI: 10.3109/02699052.2015.1005135.
Tirapu-Ustárroz, J. (2008). ¿Para qué sirve el cerebro? Bilbao: Desclée de Brouwer.
Villalobos, D., Bilbao, A., López-Muñoz, F. & Pacios, J. (2020). Conciencia de déficit como proceso clave en la rehabilitación de pacientes con daño cerebral adquirido: revisión sistemática. Revista de Neurología, 70(1), 1-11.
Wenn Ihnen dieser Beitrag über das Bewusstsein der Defizite bei der Genesung nach erworbener Hirnschädigung gefallen hat, könnten Sie an diesen Publikationen von NeuronUP interessiert sein:
Dieser Artikel wurde übersetzt; Link zum Originalartikel auf Spanisch:
La consciencia de los déficits en la recuperación del daño cerebral adquirido





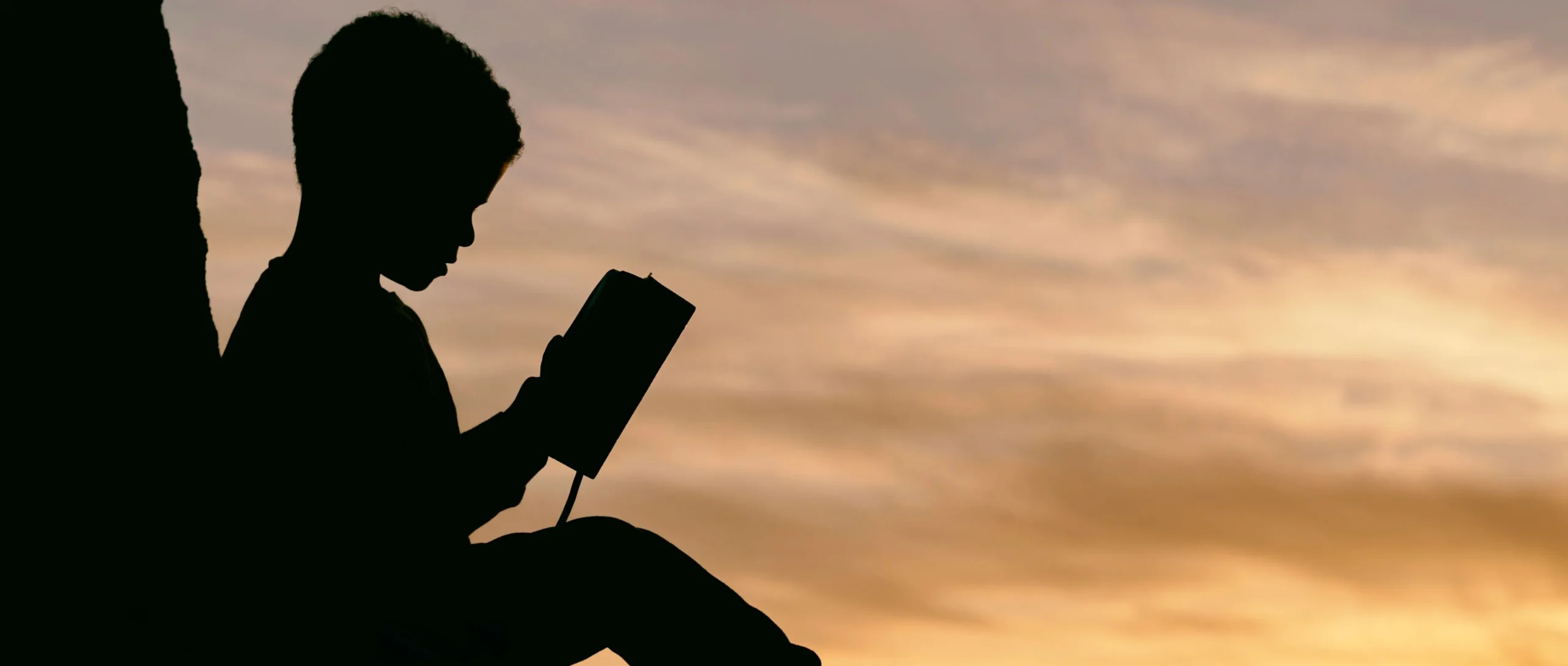
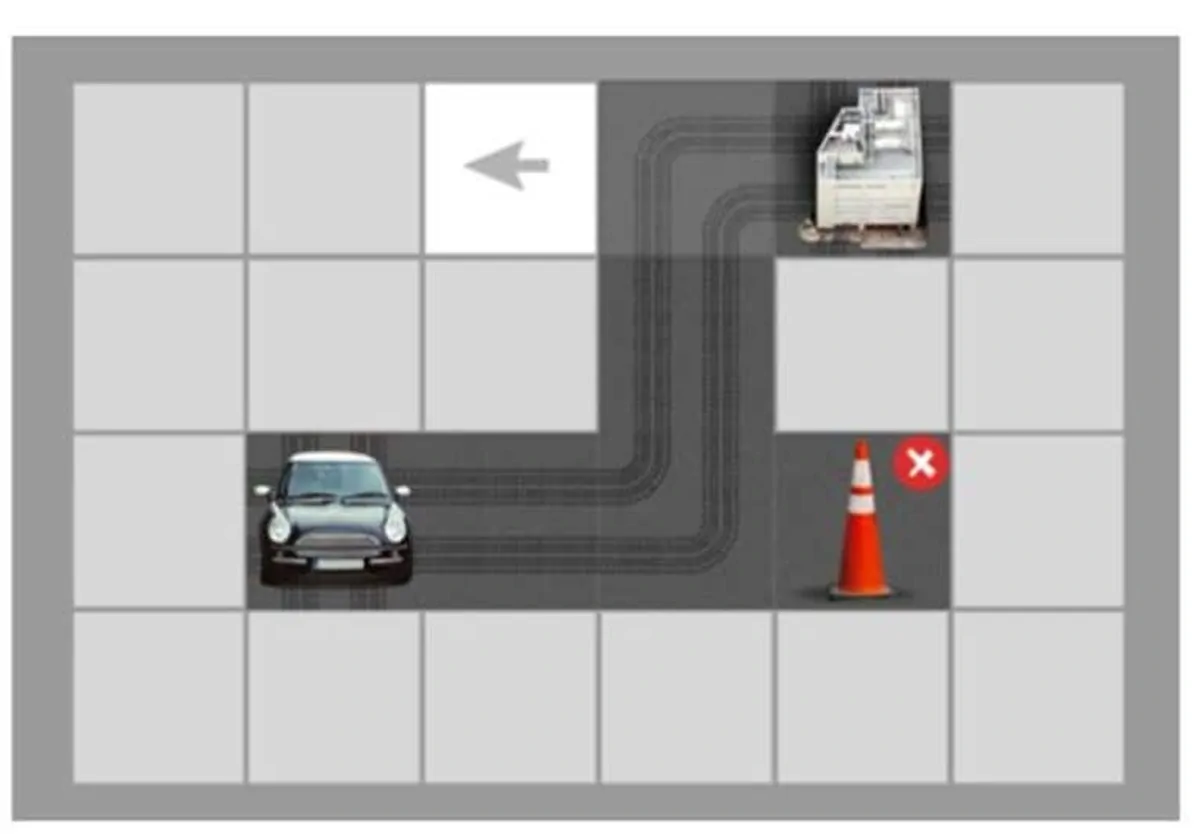
Schreiben Sie einen Kommentar